„Sprachwandel muss ja nichts Schlechtes sein“
Reihe „Wie kommt Wissenschaft in die Politik?“: Prof. Dr. Karina Frick
28.08.2025 In der Reihe „Wie kommt Wissenschaft in die Politik?“ stellen wir Forschende der Leuphana vor, die ihre Expertise in Politikbeiräten weitergeben. Prof. Dr. Karina Frick zum Beispiel ist seit Anfang 2024 Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. In ihrer Forschung stellt die Juniorprofessorin für angewandte Linguistik zeitgemäße Fragen, zum Beispiel ob Emojis nur etwas für Schreibfaule sind.
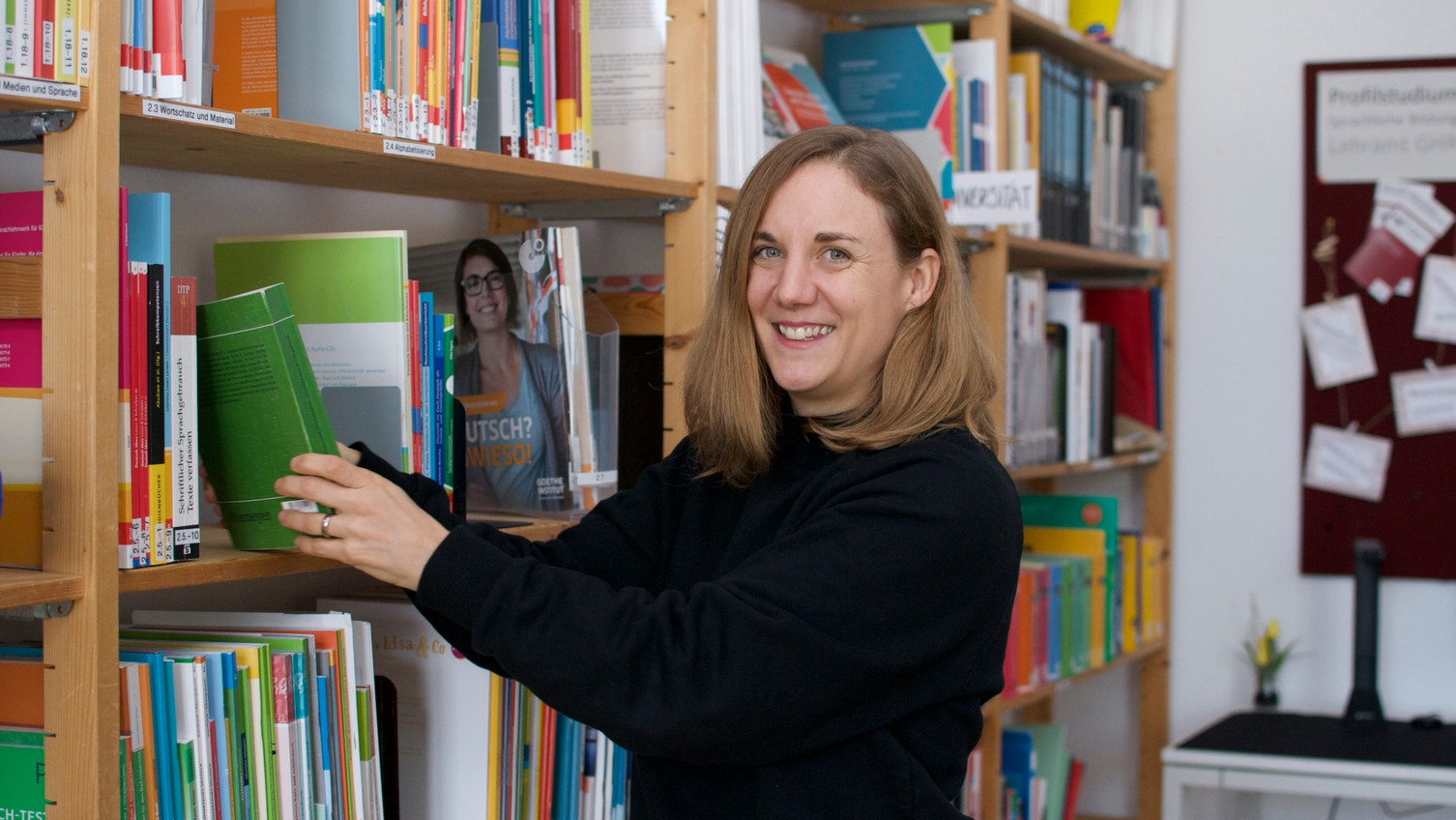 ©Leuphana Universität Lüneburg, Karina Frick
©Leuphana Universität Lüneburg, Karina Frick
Die Beobachtung hat wohl jeder schon einmal gemacht, der in sozialen Medien unterwegs ist: „Dort wird Rechtschreibung wie eine Waffe eingesetzt“, sagt Karina Frick. So machten sich auf den Plattformen häufig Menschen über andere lustig, deren Posts Rechtschreibfehler aufweisen. „Die argumentieren dann nach dem Motto: ‚Wenn du nicht richtig schreiben kannst, dann kannst du hier nicht mitdiskutieren‘ – und das in einem Raum, der angeblich normfrei sein soll“, erzählt Karina Frick. Das sage viel darüber aus, wie wichtig vielen Menschen Rechtschreibung ist, meint die Juniorprofessorin für angewandte Linguistik der Leuphana Universität Lüneburg.
„Die Metaebene, also das Sprechen über Sprache finde ich wahnsinnig interessant“, sagt die Forscherin. Dafür hat sie seit Anfang 2024 noch mehr Gelegenheit als durch ihre Arbeit an der Universität ohnehin schon. Denn seither ist sie Teil des Rates für deutsche Rechtschreibung, also dem zwischenstaatlichen Gremium, das länderübergreifend die Regeln erarbeitet. Die 41 Mitglieder überprüfen, ob die bisherigen Regeln noch zeitgemäß sind, passen sie bei Bedarf an und geben das für die deutschsprachigen Länder verbindliche Amtliche Regelwerk heraus. Die darin festgehalten Regeln finden sich beispielsweise im Duden, dessen Redaktion ebenfalls im Rat sitzt, und in der Autokorrektur von Schreibprogrammen.
Karina Frick sitzt für Liechtenstein im Rat – die Forscherin ist dort geboren. Ins Leben gerufen wurde der Rat im Dezember 2004 zudem von Österreich, der Schweiz, Südtirol, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und Deutschland. Beauftragt wird das Gremium mit seiner Arbeit von den staatlichen Stellen.
Die Faszination für Sprachfragen wurde bei Frick ganz zu Beginn ihres Studiums geweckt: Während ihres Bachelor-Studiums belegte sie ein Seminar, das sich unter anderem dem Sprachgebrauch in Daily Soaps widmete. „Es war augenöffnend dafür, was man alles untersuchen kann“, erinnert sich Karina Frick, die sich deshalb ab dem Master nur noch der Linguistik widmete. In ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit der Grammatik in schweizerdeutschen SMS. Die Orthografie beschäftige sie noch nicht so lange. Erst als sie beobachtete, wie Sprache auf Social Media eingesetzt wird, war ihr Interesse geweckt.
Die Forschung von Karina Frick hat also einen ganz praktischen Kern. Ähnlich lebensnah gehe es oft auch im Rat für deutsche Rechtschreibung zu. Sie nennt ein Beispiel: den Gebrauch des Gendersterns, der nicht nur in Politik und Gesellschaft intensiv diskutiert wurde. „Als das Thema im Rat behandelt wurde, war ich aber noch nicht Mitglied“, sagt Frick.
Die Mitglieder des Rates sind in drei Arbeitsgruppen (AG) tätig: AG Schreibbeobachtung und Lexikografie, AG Lernen und Lehren und AG Linguistik. Hier hat Karina Frick den Co-Vorsitz. Der Rat tagt zwei Mal im Jahr, um Positionen auszutauschen und Grundsatzfragen zu klären. Zudem berichten die Arbeitsgruppen aus ihren Treffen, die zwischen den Plenen nach Bedarf stattfinden. In der Regel tagt der Rat im Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, wo sich die Geschäftsstelle befindet. Hin und wieder aber trifft sich der Rat auch in den Ländern der Mitglieder – für Oktober 2025 beispielsweise bereitet Karina Frick ein Treffen in Vaduz (Liechtenstein) vor.
Die Mitglieder des Rats für deutsche Rechtschreibung sind ehrenamtlich tätig. Sie üben Berufe aus, die besonders für die Arbeit im Rat qualifizieren. Darunter sind nicht nur Wissenschaftler*innen, sondern Sprachpraktiker*innen aus dem Verlagswesen, der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, aus dem pädagogischen sowie aus dem journalistischen und schriftstellerischen Bereich. Sie kommen aus sieben Ländern und Regionen: 18 kommen aus Deutschland, je neun aus Österreich und der Schweiz, jeweils einer aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und von der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Das Grossherzogtum Luxemburg ist ohne Stimmrecht dabei.
Fricks ehemalige Gymnasiallehrerin, Renate Gebele Hirschlehner,hat sie als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen.Diese ist mit Beginn des Schuljahres 2022/23 in den Ruhestand gewechselt, nachdem sie sich im Rat 17 Jahre lang für die deutsche Rechtschreibung eingesetzt hatte. Karina Frick ist von Liechtenstein aus zunächst fürs Studium nach Zürich gegangen und war danach an der Universität Lausanne der Universität Basel sowie der PH Zürich tätig, bevor sie nach Lüneburg gekommen ist.
Und was hat die Gesellschaft von ihrer Arbeit im Rat und an der Universität? „Eine Sensibilisierung für den Gebrauch von Sprache wäre schön. Viele denken ja, dass Rechtschreibung eine feststehende Kategorie ist, die sich nicht ändert. Aber sie ist kein starres Gebilde“, sagt Karina Frick. Dann sagt sie noch: „Ich versuche den Leuten zu zeigen, dass Sprachwandel nichts Schlechtes sein muss.“
