LIAS Panel Diskussion: Disalienation and Praxis: Experiments in Institutional Critique
11. Juni
Datum: 11. Juni, 18–20 Uhr
Ort: Zentralgebäude C40.704
Mit: Nancy Luxon, LISA Senior Fellow | Kerstin Stakemeier, LIAS Alumna, AdBK Nürnberg | Romain Tiquet, Centre Marc Bloch Berlin | Elena Vogman, Institut für Cultural Inquiry Berlin
Moderation: Susanne Leeb, LIAS Co-Direktorin
Im Zuge der zunehmenden faschistischen und kolonialen Gewalt in den 1930er Jahren experimentierte eine Gruppe radikaler Psychiater mit sozialen und institutionellen Praktiken, die unter dem Begriff »disalienation« zusammengefasst wurden. Im Mittelpunkt dieser Entfremdungspraxis stand die Überzeugung, dass die sozialen Beziehungen unter einer »Pathologie der Freiheit« und nicht unter individuellen Gesundheitsproblemen litten. Soziale und geistige Entfremdung waren untrennbar miteinander verwoben. Diese Praktiker – von Francesc Tosquelles über Frantz Fanon bis hin zu Henri Collomb – experimentierten mit der Schaffung flexiblerer Institutionen, die neue akustische Räume für die Sinngebung, Freiheit des Körpers und der Gedanken und Orte für das Spiel der Fantasie bieten sollten. Im Idealfall würden solche Räume einen andersartigen Schutzraum für das Erleben von Neurosen, Schizophrenie und Psychosen bieten, das tief mit der Gewalt des Faschismus und des Kolonialismus verbunden ist. Indem diese Experimente alle Beteiligten (und nicht nur die Patient*innen) betrafen, versuchten sie, die Bedingungen der Kollektivität und das Wissen, durch das sie sich selbst versteht, neu zu überdenken und zu humanisieren. Die Entfremdung wurde zu einem Versuch, unsere Bindungen an eine entfremdende Politik, ein entfremdetes soziales Leben und eine entfremdete Wissensbildung aufzulösen. Jeder der vier Beiträge auf diesem Podium befasst sich mit einem anderen Aspekt dieses Projekts, um seine Auswirkungen auf die Fantasien über andere Möglichkeiten des heutigen Seins zu durchdenken.
Fantasies of Disalienation
Kerstin Stakemeier
Der Begriff disalienation, der aus der psychiatrischen Praxis im Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts hervorgegangen ist, bezeichnet nicht das Antonym der Entfremdung. So wie die Entfremdung eine Praxis ist – eine Praxis der romantischen Subjektivierung –, so kennzeichnet auch die disalienation eine Form der Individuation: eine, die Entfremdung auflöst und die Fantasien, die ihren Vorstellungen zugrunde liegen, ins Spiel bringt. Ich möchte zeigen, dass disalienation als eine fantasiegleitete Praxis der Integration verstanden werden sollte.
Disalienation by Design
Nancy Luxon
Wie vermitteln Institutionen zwischen sozialer und mentaler Entfremdung? In Anlehnung an Denker wie Foucault, Goffman und Althusser werden Institutionen oft einfach als Beitrag zu bestehenden Ordnungen und deren Interpellationen verstanden. Insbesondere die kolonialen Krankenhäuser wurden lange Zeit als mitschuldig an der Untermauerung eindeutiger politischer Muster der Ausgrenzung und Marginalisierung angesehen. In jüngerer Zeit haben sich Wissenschaftler*innen auf radikale institutionelle Kollektive zurückbesonnen, um die Ressourcen zu erforschen, die künftig für langfristige antikoloniale und antirassistische Herausforderungen benötigt werden. Fanons psychiatrische Krankenhäuser in Algerien und Tunesien sowie die Lafargue-Klinik in Harlem spielten eine zentrale Rolle bei der Umdeutung rassifizierender Ungleichheit in Begriffe der psychischen Verletzung (USA) oder der Entfremdung (Nordafrika). Anstatt in utopischen und theoretischen Begriffen zu denken, werden in diesem Beitrag die Infrastrukturen – die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten, die Architektur der Einrichtung und das Pflegepersonal – näher untersucht, die es ermöglichten, dass bestimmte infrastrukturelle Räume als Dreh- und Angelpunkte des politischen Wandels dienen konnten, während andere in bestehenden Praktiken der Marginalisierung und des Ausschlusses verhaftet blieben. Auf der Grundlage von Archivmaterial aus dem Hôpital Psychiatrique de Blida untersucht dieser Beitrag die architektonische Gestaltung einer Reihe von Krankenhäusern in Europa und Nordafrika in den 1930er- bis 1960er-Jahren, die Neuausrichtung des Krankenhauses als soziale Institution – weg von den Praktiken der Vichy-Regierung und der Rassentrennung und hin zur politischen Revolution – sowie die Praktiken, die diese Krankenhäuser zu „Zwischenräumen“ machten, um den politischen und sozialen Wandel zu unterstützen. Dieser Beitrag bietet somit eine neue Vorstellung davon, wie Institutionen Menschen, Materialien und die Wiederholungen der sozialen Zeit wieder in Umlauf bringen können, um die „Herrschaft“ und ihre strukturierende Wiederkehr innerhalb der politischen und sozialen Ordnung zu beseitigen.
Geopsychiatry and Disalienation
Elena Vogman
Dieser Vortrag befasst sich mit den Medienpraktiken, die im Zuge der „Institutionellen Psychotherapie“ entwickelt wurden, durch das Prisma der „Geopsychiatrie“. Die Anstaltspsychotherapie war eine psychiatrische Reform- und Widerstandsbewegung, die im Nachkriegsfrankreich unter anderem von Francesc Tosquelles, Lucien Bonnafé und Frantz Fanon gegen die rassistische und ableistische Vernichtung von Patient*innen mit geistigen und körperlichen Behinderungen initiiert wurde. Die Geopsychiatrie schlug einen ökologischen und dekolonialen Ansatz für die psychiatrische Versorgung vor: Sie (re)politisierte den Begriff der „Humangeografie“, womit sie auch die Raumpolitik der Gesellschaft inklusive ihrer konzentrativen Formen des Einsperrens infrage stellte. Medien wie Film, Fotografie, Druck und Kartografie dienten dazu, die Geografie der Gegenwart kollektiv neu zu erfinden und zu imaginieren. Dabei ging es darum, Umgebungen, Institutionen und Milieus zu schaffen, die psychologische Therapie und Heilung erleichtern. Als Praktiken des Widerstands erscheinen diese Interventionen angesichts der aktuellen Debatten über Medien und Umwelt sowie über die soziale und partizipative Umfunktionierung von Technologie im Rahmen eines Projekts der disalienation von entscheidender Bedeutung.
Elena Vogman ist Literatur- und Medienwissenschaftlerin. Sie ist Leiterin des Forschungsprojekts „Madness, Media, Milieus: Reconfiguring the Humanities in Postwar Europe“ an der Bauhaus-Universität Weimar und Visiting Fellow am ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry. Ihre aktuelle Arbeit konzentriert sich auf die Mediengeschichte der Institutionellen Psychotherapie und deren Überschneidungen mit dekolonialen Diskursen, Psychoanalyse, Feminismus und ökologischem Denken. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht: Sinnliches Denken. Eisensteins exzentrische Methode (2018) und Dance of Values: Sergei Eisenstein‘s Capital Project (2019).
Imported Psychiatry and “Patient voices”: Reconsidering the “Fann School” in Senegal through a Patient File
Romain Tiquet
Dieser Beitrag befasst sich mit einer Patientenakte, die im Rahmen der psychiatrisch- therapeutischen Betreuung in Fann in Dakar (Senegal) Mitte der 1960er-Jahre angelegt wurde. Die Klinik von Fann, die 1956, nur wenige Jahre vor der Unabhängigkeit Senegals, eröffnet wurde, entwickelte sich schnell zu einem Zentrum für transkulturelle Psychiatrie und zu einem Knotenpunkt für intensive Überlegungen zur afrikanischen Psychopathologie. Die Einrichtung wurde maßgeblich von Henri Collomb und seinem Team geprägt, die eine „Psychiatrie ohne Grenzen“ entwickeln wollten – eine Psychiatrie, die darauf abzielte, die Mauern der kolonialen Anstalt zu überwinden, lokale Auffassungen und Darstellungen von psychischen Störungen zu integrieren und die Stimmen der Patient*innen in den Mittelpunkt des therapeutischen Prozesses zu stellen. Collomb brachte Forschende der psychiatrischen Psychoanalyse, Ethnologie, Soziologie und Anthropologie zusammen, um die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Dimensionen psychischer Erkrankungen im Senegal und im weiteren Sinne in Afrika zu untersuchen. Anhand der Akte von Moustapha H., der in den Jahren 1965 und 1967 in der psychiatrischen Klinik behandelt wurde, soll in diesem Beitrag analysiert werden, wie der auf die „Befreiung der Sprache“ ausgerichtete Ansatz von Fann eine echte Berücksichtigung der Aussagen der Patient*innen und ihrer Familien ermöglichte. In diesem Beitrag werden klinische Erkenntnisse mit einer historischen Perspektive verwoben, wobei drei Arten der Konzeptualisierung des Patienten untersucht werden. Zunächst werde ich den „Patienten als Akteur“ untersuchen. Die Betonung der Sprachbefreiung, die im Mittelpunkt von Fanns therapeutischem Ansatz stand, sorgte dafür, dass die Stimmen von Patient*innen und Familienangehörigen nicht nur ernst genommen wurden, sondern auch als therapeutisches Mittel und wertvolle Ressource für Historiker*innen dienten. Zweitens werde ich den „Patienten als Symptom“ untersuchen, indem ich den Fokus von der Erkrankung selbst auf das verlagere, was die psychischen Manifestationen des Patienten über den breiteren sozialen, kulturellen und historischen Kontext offenbaren – wie etwa familiäre Spannungen oder das „kulturelle Dazwischen“ einer zunehmend urbanisierten postkolonialen Gesellschaft. Abschließend werde ich den „Patienten als Objekt“ erörtern. Sowohl das medizinische Team von Fann als auch die Historiker*innen laufen Gefahr, den Patienten und seine Familie zu bloßen Subjekten der kulturellen Analyse zu machen und sie damit in einen starren Interpretationsrahmen zu zwängen. In diesem letzten Abschnitt zeige ich die Grenzen des Fann-Experiments und die methodischen Herausforderungen auf, auf die Historiker*innen stoßen, wenn sie psychiatrische Patientenakten als Quellen für die Sozialgeschichte nutzen.
Romain Tiquet promovierte in Afrikastudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist seit 2019 CNRS-Forscher am Institut des Mondes Africains (MMSH Aix-en- Provence) und seit dem 1. September 2022 am Centre Marc Bloch in Berlin. Nach seiner Arbeit über Zwangsarbeit im Senegal hat er seinen Schwerpunkt auf die Geschichte des Wahnsinns in Westafrika gelegt. Er leitet das ERC-Projekt „Governing Madness in West Africa“ (MadAf 2021–2026). Er hat mehrere Artikel über Patient*innenakten und methodologische Überlegungen zu Quellen für die Erforschung der Geschichte des Wahnsinns in Westafrika veröffentlicht.
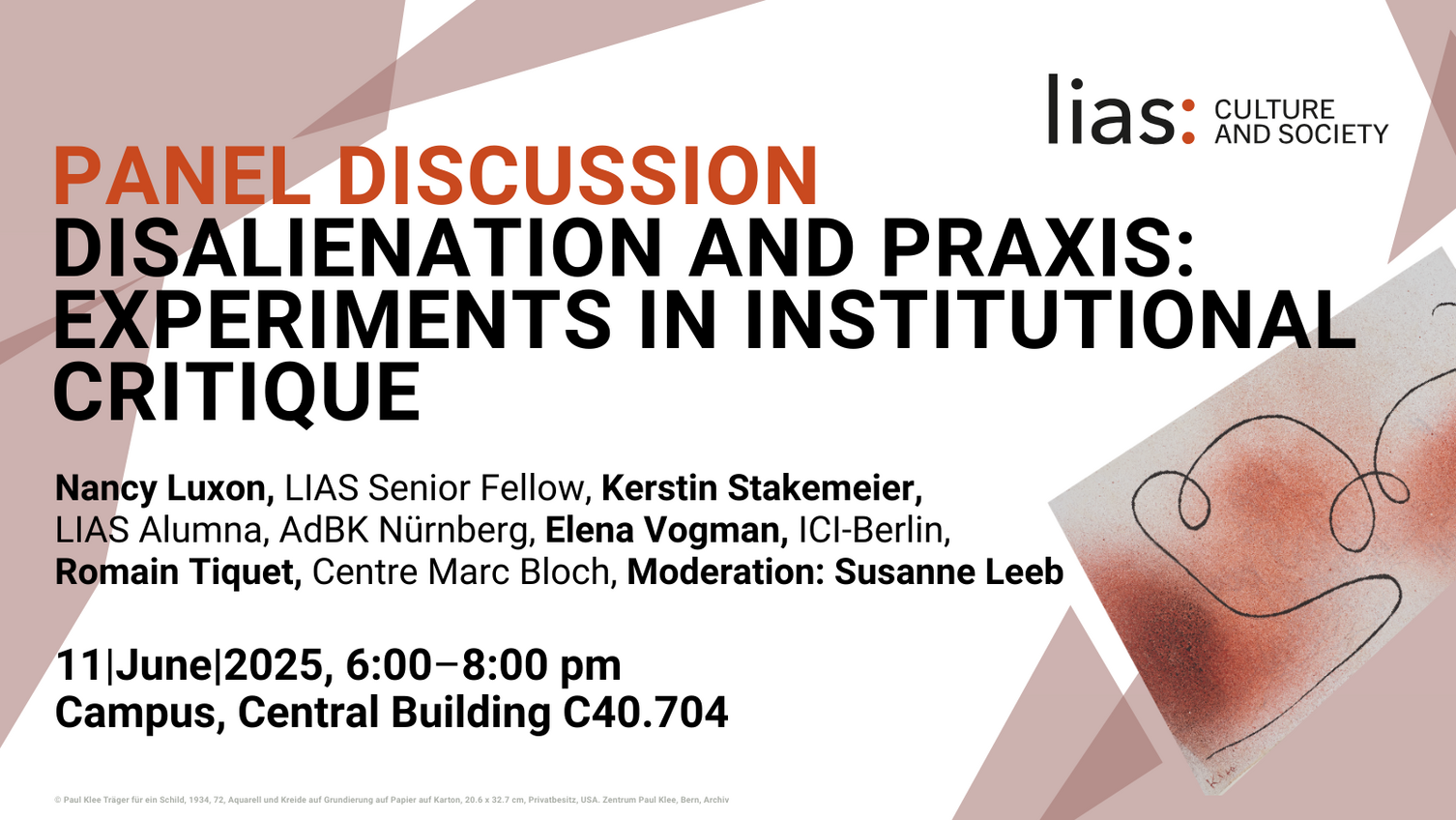 ©LIAS
©LIAS
Anfragen und Kontakt:
- Dr. Christine Kramer
