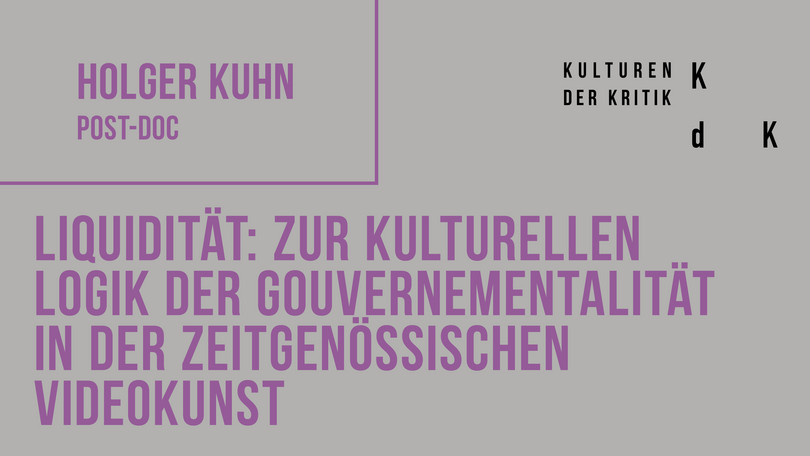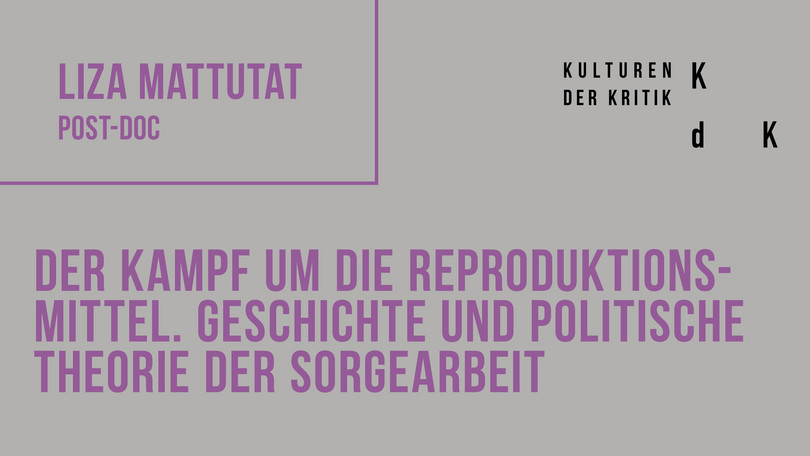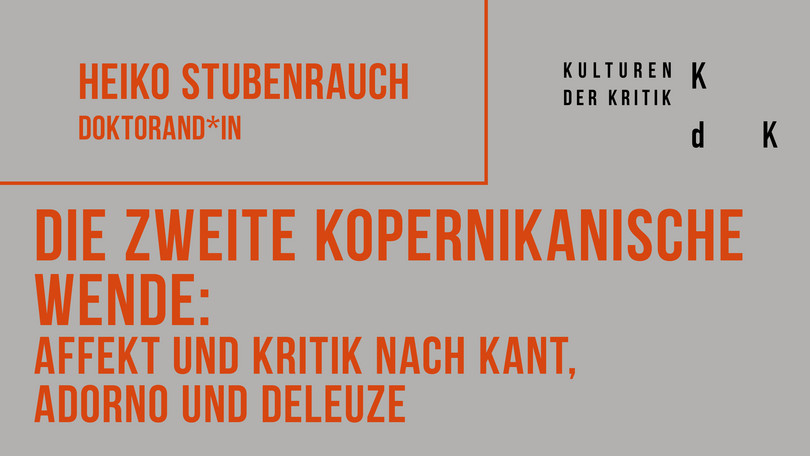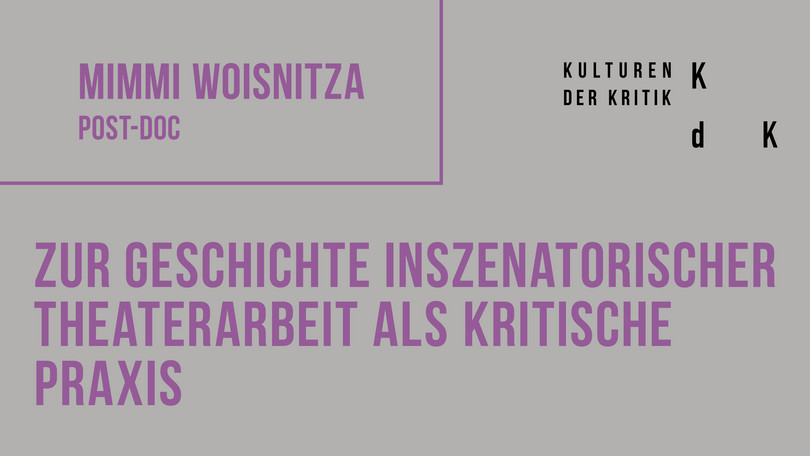Post-Doktorand*innen
Lukas Betzler
Sami Khatib
Holger Kuhn
Liza Mattutat (aktueller Kontakt)
Heiko Stubenrauch
Mimmi Woisnitza
- Lukas Betzler
Kontakt: lukas.betzler@leuphana.de
‚Cultural Aspects of National Socialism‘. Rekonstruktion eines unvollendeten Projekts des Instituts für Sozialforschung
In meinem Postdoc-Projekt widme ich mich einem unvollendeten Forschungsvorhaben, welches das Institut für Sozialforschung (IfS) in den Jahren 1940 und 1941 im New Yorker Exil unter Leitung Max Horkheimers konzipierte. An dem intern als „German Project“ oder auch „Deutschlandprojekt“ bezeichneten Plan einer Studie zur Vor- und Frühgeschichte des Nationalsozialismus waren sämtliche Institutsmitglieder beteiligt. Der Plan blieb jedoch unausgeführt, weil der Antrag – es war der erste Drittmittelantrag, den das IfS stellte – von der Rockefeller Foundation abgelehnt wurde. Das research proposal mit dem Titel „Cultural Aspects of National Socialism“ sowie unzählige drafts und weitere Vorarbeiten sind unveröffentlicht und in verschiedenen Archiven erhalten – insbesondere im Max-Horkheimer-Archiv in Frankfurt am Main.
Mein Forschungsprojekt macht dieses einzigartige, in der Forschung bisher jedoch kaum beachtete Material – insgesamt etwa 2.000 Blatt – zum Gegenstand einer drei Ebenen umfassenden Untersuchung: Praxeologisch rekonstruiere ich am Material die kollektiven und kollaborativen Arbeitsweisen am IfS; theoriegeschichtlich untersuche ich den in den verschiedenen Arbeitsstadien des Projekts zu beobachtenden Wandel der sozialtheoretischen Erklärungsmodelle für den Nationalsozialismus; und wissenschaftsgeschichtlich untersuche ich das Projekt als Dokument eines transatlantischen Theorietransfers und der Bemühung des IfS, sich unter den Bedingungen des Exils im Feld der amerikanischen Sozialwissenschaften zu etablieren. Auf allen drei Ebenen zeigt sich die wechselseitige Durchdringung des (sozial-)wissenschaftlichen und des politischen Felds: die Abhängigkeit der theoretischen Produktion von konkreten Arbeitsbedingungen, politischen Ereignissen und ökonomischen Machtverhältnissen. Die so gewonnenen Erkenntnisse schärfen den Blick für die gesellschaftliche Lage auch der heutigen sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und seinem Fortleben in der Gegenwart.
Sami Khatib
Ästhetik des Sinnlich-Übersinnlichen: Von der Kritik des Spektakels zur spekulativen Kritik
An der Schnittstelle von Dekonstruktion, Ästhetik und Medientheorie fragt mein Forschungsprojekt nach den Konsequenzen der Marxschen Entdeckung des Topos des „Sinnlich-Übersinnlichen“: Gibt es ein Medium, in dem sich die nichtempirische Materialität gesellschaftlicher Beziehungen im Kapitalismus darstellen lässt? Medium meint hier nicht vermittelnder Zwischenraum, sondern eine je historisch spezifische Konstellation von Raum, Zeit, Sprache und Technik. Die Ästhetik des Sinnlich-Übersinnlichen verweist somit auf einen Bereich nichtempirischer Materialität, in dem warenförmige Verhältnisse in ihrer räumlichen, zeitlichen, sprachlichen und technischen Verfasstheit ins Bild treten. Der Modus der Bildwerdung ist vom (selbst)bewussten Erkenntnissubjekt entkoppelt und erschließt Forschungsgebiete, die unbewusste Strukturen in Sprache, Politik und Ökonomie in den Blick nehmen. Kritische Begriffe wie „Ware“, „Spektakel“ und „Phantasma“ lassen sich dergestalt als dezentrierte Bildproduktionen im Medium des Sinnlich-Übersinnlichen begreifen.
Sami Khatib war im WS 2017/18 und von Oktober 2018 bis September 2019 im Kolleg als Gastwissenschaftler tätig.
Holger Kuhn
Das Projekt untersucht künstlerische Videos und Filme seit 2008, die einerseits auf die voranschreitende Finanzialisierung der Ökonomie und andererseits auf gouvernementale Machttechnologien (M. Foucault) reagieren. Untersuchungsgegenstand sind dabei Videos und Filme, die auf hervorstechende Art und Weise die Frage nach der Darstellbarkeit des Kapitalismus, des Finanzkapitals, von Kapitalflüssen oder auch der globalen Ökonomie adressieren (etwa bei Melanie Gilligan, Allan Sekula, Hito Steyerl etc.). Sie treten auf jeweils unterschiedliche Art der Annahme entgegen, dass der Kapitalismus als umfassende gesellschaftliche Dynamik nicht in visuellen und filmischen Medien darstellbar sei, und entwickeln divergierende Strategien, mit denen diese Undarstellbarkeit kommentiert oder unterlaufen wird: 1. mittels figurierender Darstellungsweisen, 2. mittels struktureller Homologien, 3. durch symptomatische Lesarten historischer Lagerungen des Kapitalismus. Im zweiten Schritt geht das Projekt von der Beobachtung aus, dass sich in den zu untersuchenden Videos formale Strukturen, Semiotiken oder Poetiken der Verflüssigung, der Liquidität, des Flows und der Gasförmigkeit nachzeichnen lassen, die aus Verschiebungen in den gouvernementalen Machtstrukturen resultieren. Ziel ist es, die Potenziale künstlerisch-kritischer Praktiken zu untersuchen, die danach trachten, nicht nur die kulturelle Logik jüngerer Verschiebungen in den ökonomischen Machtstrukturen zu registrieren, die unter Begriffen wie Spätkapitalismus, surveillance- oder capture-capitalism diskutiert werden, sondern sie auch erfahr- und damit überhaupt erst prägnant kritisierbar zu machen.
Die unentrinnbare Verflechtung von kulturellen Produkten und finanziellem Wissen mündet hier gerade nicht in die These vom „Elend“ oder der „Kooptierbarkeit“ von Kritik. Ganz im Gegenteil lassen sich an den künstlerischen Arbeiten unterschiedliche Wege, Formen, Formate der Kritik beschreiben, die gerade aus dem Problem der Verflechtung jeder kritischen Subjektivität mit den Prozessen der Macht heraus auf eine Machtanalyse zielen, die im Sinne von Foucault auf die Nicht-Notwendigkeit und Nicht-Akzeptabilität spezifischer Konfigurationen von Wissen und Macht bzw. von „Wahrheitsregimen“ (M. Foucault) abhebt.
- Dr. Liza Mattutat
Kontakt: liza.mattutat@leuphana.de
Care in Crisis. Über die Zukunft vergangener Utopien der Sorgearbeit
In den vergangenen Jahren mehren sich Krisendiagnosen, die den Zustand der Sorgearbeit ins Zentrum rücken. Im Projekt Care in Crisis geht es um diese Diagnosen, ihre historischen Vorläufer und um die Gegenmittel, die die (Früh-)Geschichte des Feminismus in Reaktion auf solche Krisenerfahrungen entwickelt hat.
Das Projekt diskutiert bestehende Krisendiagnosen mit Blick auf die Frage, welcher Begriff von Krise die gegenwärtigen Verwerfungen im Bereich der sozialen Reproduktion erfassen kann. Um einen solchen Krisenbegriff zu entwickeln, erweitert es marxistische Krisentheorien. Da das Lohnarbeitssystem auf der un- und unterbezahlter Sorgearbeit beruht, sind Wirtschaftskrisen immer auch Sorgekrisen.
Im nächsten Schritt untersucht das Projekt die Symptome der gegenwärtigen Sorgekrise in Deutschland. Dazu recherchiert und interpretiert es die familien-, sozial-, migrations- und gesundheitspolitischen Reformen der vergangenen Jahre. Welche familisierenden und/oder defamilisierenden Maßnahmen wurde ergriffen? Welche pro- und/oder antinatalistischen Politiken werden eingesetzt? Welche Diskurse werden rund um die Sorgearbeit geführt?
Schließlich und ganz wesentlich interessiert sich das Projekt für die Krisenreaktionen, die die Geschichte des Feminismus für vergleichbare Krisen bereithält. Feministische Bewegungen haben in der Vergangenheit zu (mindestens) fünf verschiedenen Mitteln gegriffen: 1) Sie haben die Sorgearbeit verweigert, wie zum Beispiel während des isländischen Frauenstreiks 1975. 2) Sie haben Hausarbeits-Kooperativen gebildet, wie etwa die Cambridge Cooperative Housekeeping Association (1869-1871). 3) Sie haben sich an utopischen Siedlungsprojekten beteiligt, wie etwa in der sozialistischen Siedlung Llano del Rio, CA, USA (1914-1917). 4) Sie haben eine Bezahlung der Hausarbeit gefordert, wie die internationale Lohn für Hausarbeit-Bewegung (1972-1977). 5) Sie haben auf eine Rationalisierung der Hausarbeit gesetzt, was sich etwa in der „Frankfurter Küche“ der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky zeigt (1926). Care in Crisis untersucht diese Krisenreaktionen in fünf Case Studies, die Archivarbeit und Interview miteinander verbinden. Welche Auswirkungen hatten diese historischen Experimente und Initiativen auf die Gegenwart? Was können wir heute von ihnen lernen?
CV
Liza Mattutat ist Philosophin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg. Seit 2021 arbeitet sie als Postdoc im Graduiertenkolleg Kulturen der Kritik, in dessen Rahmen sie zwischen 2016 bis 2019 bereits promovierte. In der Zwischenzeit hat sie ein Kind bekommen und, unterstützt durch ein Stipendium des Landes Niedersachsen, ihre Doktorarbeit abgeschlossen. Diese erschien 2022 als Emanzipation und Gewalt. Feministischer Rechtskritik mit Karl Marx, Jacques Derrida und Gilles Deleuze bei J.B. Metzler in Stuttgart. Vor ihrer Zeit in Lüneburg hat Liza Mattutat 2015-2016 in der Nachwuchsforschungsgruppe Jenseits einer Politik des Strafens gearbeitet, die an der Uni Kassel das retributive Straf- und Gefängnissystem problematisierte und alternative Perspektiven auf Gerechtigkeit erforschte. Davor hat sie von 2006 bis 2014 Philosophie und Germanistik an der TU Darmstadt studiert.
Liza Mattutats Forschungsinteressen liegen in der feministischer Theorie und Geschichte, Rechtsphilosophie und K/kritischer Theorie.
- Dr. Heiko Stubenrauch
Obwohl sie nicht viel verbindet, so verbindet sie doch ihre Kantlektüre. Theodor W. Adorno und Gilles Deleuze behaupten, dass dieser in seiner Kopernikanischen Wende ein Subjekt entwerfe, welches der beruhigenden Selbstgleichheit willen die Fähigkeit zur verändernden Erfahrung der Welt einbüße. Die kritische Philosophie Kants sichere diesen Zusammenhang zwischen identischem Subjekt und unveränderbarem Gegenstand bloß ab, so dass sie die emanzipatorischen Ziele der Aufklärung nicht einzulösen im Stande sei, vielmehr in Konformismus münden müsse. Durch Kants Kopernikanische Wende seien die modernen Kritikbemühungen in eine falsche Richtung geleitet worden; eine Richtung, der sich einzig durch eine Kurskorrektur im Rückgriff auf Kant entgegenzustemmen sei: durch eine Zweite Kopernikanische Wende in der Kritik.
Dass es einer solchen Zweiten Kopernikanische Wende in der Kritik bedarf, darin sind sich Adorno und Deleuze noch einig, wie eine solche Wende genau auszusehen habe, darin weisen die Vorstellungen der beiden Philosophen jedoch stark auseinander und stellen in diesem Auseinanderweisen meiner Promotion ihre Aufgabe. Es gilt, das weite und unübersichtliche Feld dieser so verschiedenen, jedoch gleichermaßen die Identität des kantischen Transzendentalsubjekts hinter sich lassenden Kritikbegriffe zu vermessen, die Scheidewege zwischen dem negativen Kritikbegriff Adornos einerseits und dem affirmativen Kritikbegriff Deleuzes andererseits zu markieren und ihre Unterschiede als Fragestellungen zwischen einer Negativität des Leidens und einer Positivität des Begehrens, zwischen einer Dialektisierung der Urteilstheorie und einer Abwendung vom Urteilen, zwischen einer Epistemologie des Nichtidentischen und einer Ontologie des Lebens, zwischen einer Forderung nach Transzendenz und einer Affirmation der Immanenz aufzuwerfen.
- Dr. Mimmi Woisnitza
Assoziierte Postdoktorandin
Das Projekt schlägt einen Perspektivwechsel vom Regietheater, das sich auf von einem einzigen (um 1900 fast ausschließlich männlichen) Regisseur autorisierten Theaterproduktionen bezieht, hin zur Herausbildung inszenatorischer Theaterarbeit als künstlerische Praxis vor. Ein solcher Perspektivwechsel erlaubt es einerseits, neben dem etablierten und institutionalisierten Theater auch kollektive und kollaborative Theaterformen zu berücksichtigen, die sowohl politisch als auch künstlerisch autoritäre Machtstrukturen zu unterwandern versuchten. Andererseits betont das Konzept der "Inszenierung" als "in-Szene-setzen" die soziale Situiertheit sowohl etablierter als auch marginalisierter Theaterformen, indem es verschiedene, eng miteinander verbundene Register, wie die sozialen und politischen Produktions- und Aufführungsbedingungen, die Struktur und Verteilung der künstlerischen Arbeit sowie die Mittel der szenischen Darstellung, in Betracht zieht. Darüber hinaus werden auch die Intentionen und programmatischen Anliegen der Theatermacher berücksichtig, außertheatrale Gegebenheiten szenisch zu rahmen und dadurch greifbar und sichtbar zu machen. Diese Frage betrifft weit über den Aspekt des Werkbezugs oder gar der Werktreue hinausgehend den Kritikanspruch theatraler Formen. Als eine Kritikalität der Praxis, die je nachdem programmatisch oder auch immanent sein kann, wird Kritik dabei nicht rein negativ, d.h. als urteilende Analyse, verstanden. Vielmehr entspricht das für die inszenatorischen Praktiken der Theater-Avantgarde charakteristische Entwerfen und Erproben alternativer Formen des Zusammenlebens sowie der künstlerischen Arbeitsweisen und Darstellungsverfahren einem affirmativen und auf Kreativität ausgerichteten, performativen Kritikbegriff.
Als Praktiken schöpferisch affirmativer Kritik verstanden, kommen in den Theaterformen der historischen Avantgarde (1905-1927) Lebenskonzepte zum Einsatz als Gegenentwurf im Zeichen von Industrialisierung und Kapitalismus, Kriegsauswirkungen und zunehmender Nationalisierung eine zentrale Bedeutung zukommt. Der für die Avantgarden zentrale Topos der Verschleifung von Leben und Kunst betrifft die Medienspezifiität des Theaters als transitorisch-lebendige Kunst und geht damit über die oft behaupteten Bezüge zum Existenzialismus (Kierkegard, Nietzsche), zur Phänomenologie (Husserl) oder zu anderen lebensphilosophischen Strömungen (Bergson, Simmel, Plessner) hinaus. Die programmatische Forderung nach einer neuen Beziehung zwischen Leben und Kunst ist daher von ganz eigener Bedeutung für Praktiken der "Inszenierung", die Prozesse der kollektiven und kollaborativen Verlebendigung impliziert. Das Projekt nimmt drei exemplarische Fälle (Max Reinhardt, Asja Lacis, Erwin Piscator) in den Blick, um dieses Verhältnis anhand von drei miteinander in Wechselwirkung stehenden Schwerpunkten (Humanismus, (Für)Sorge, Technik) zu untersuchen.