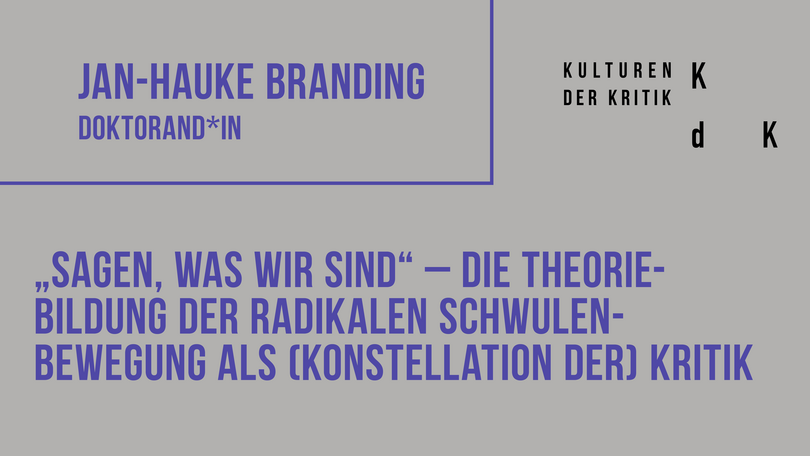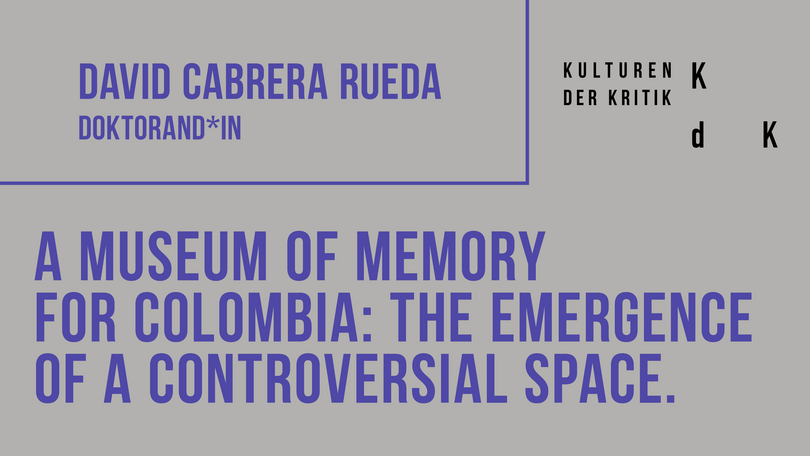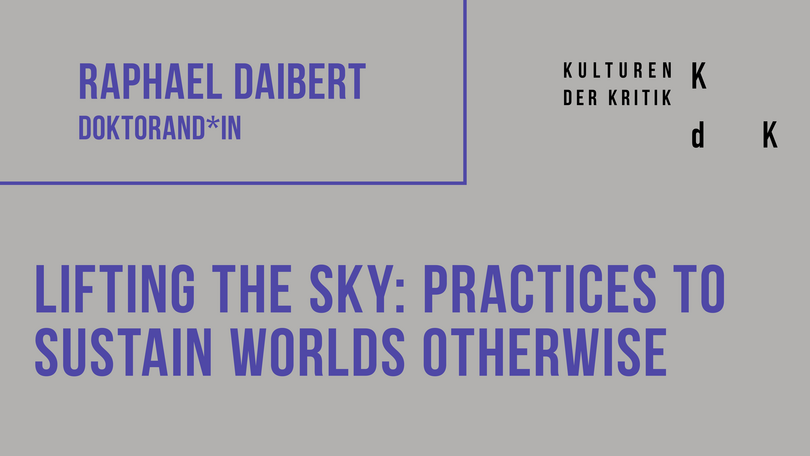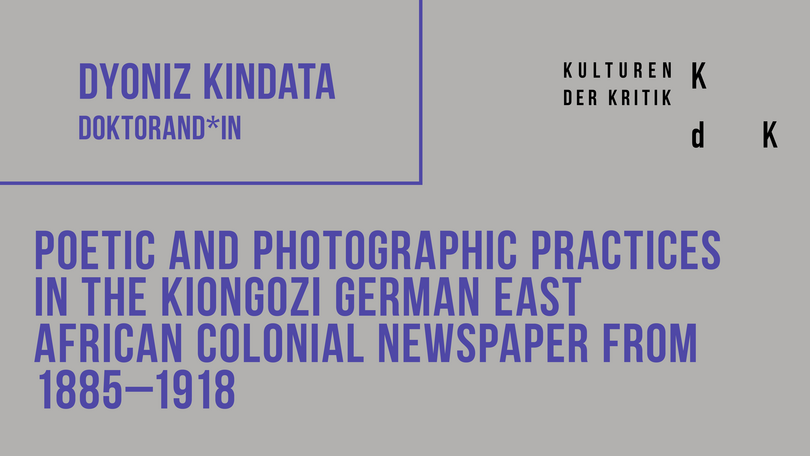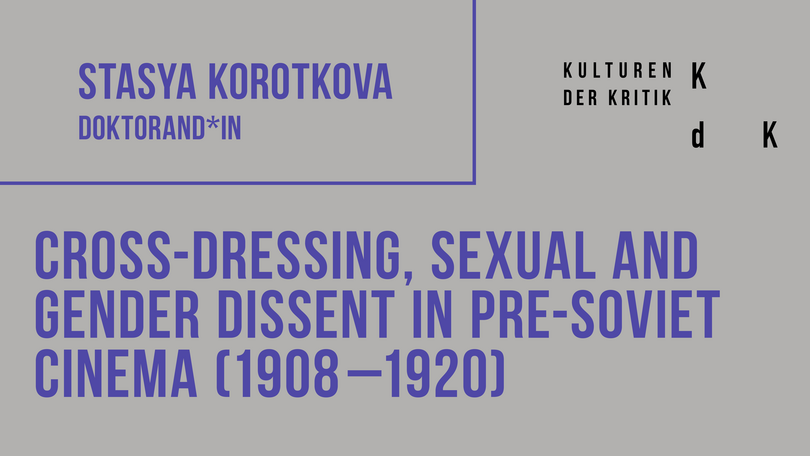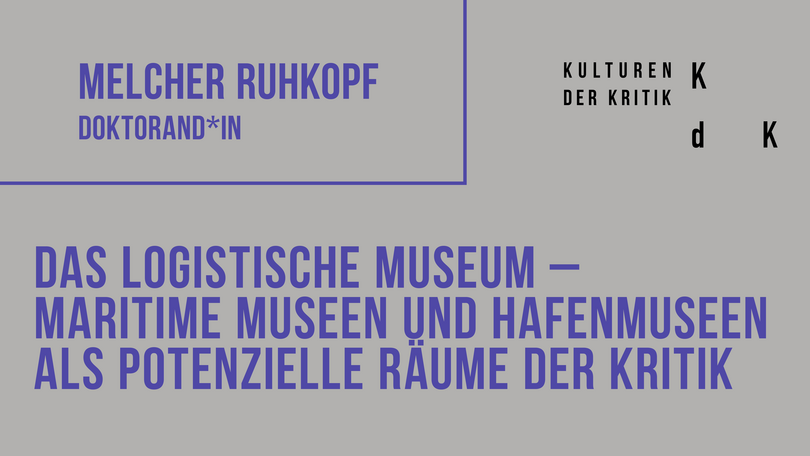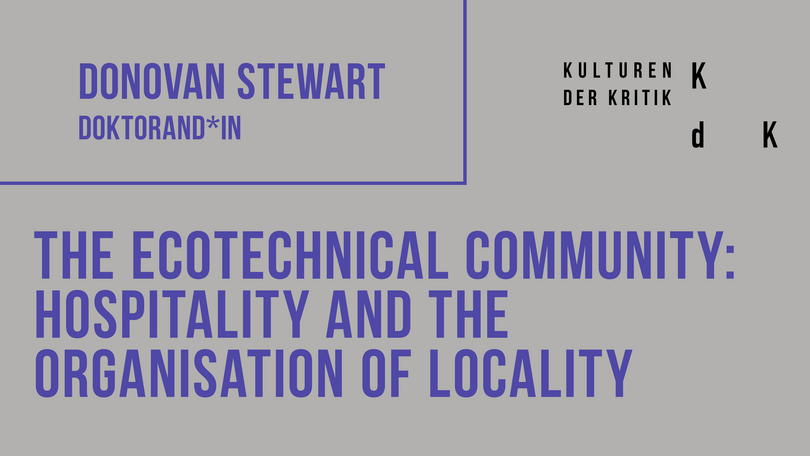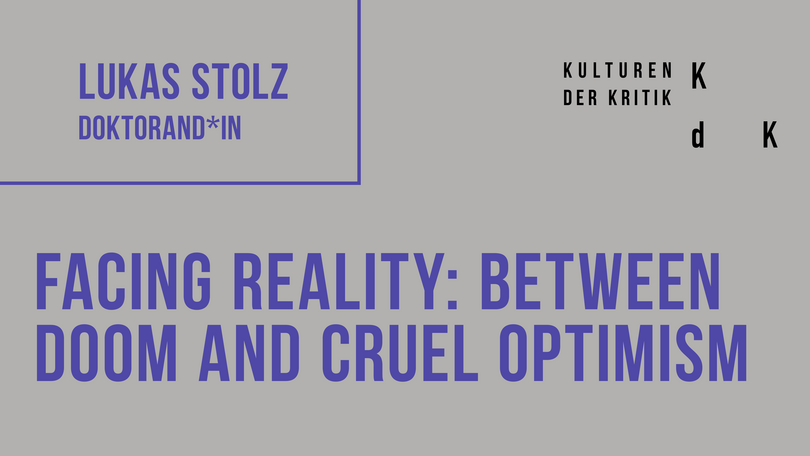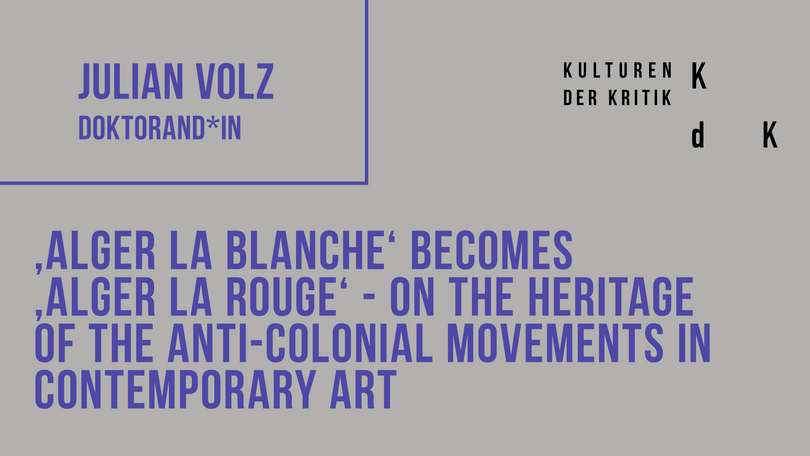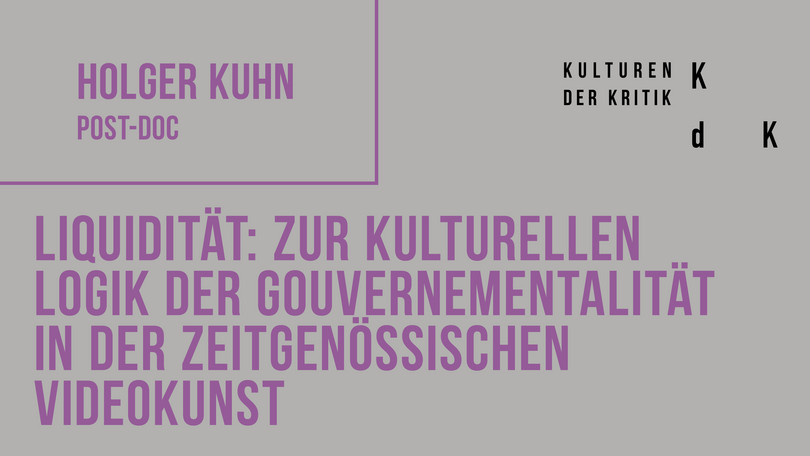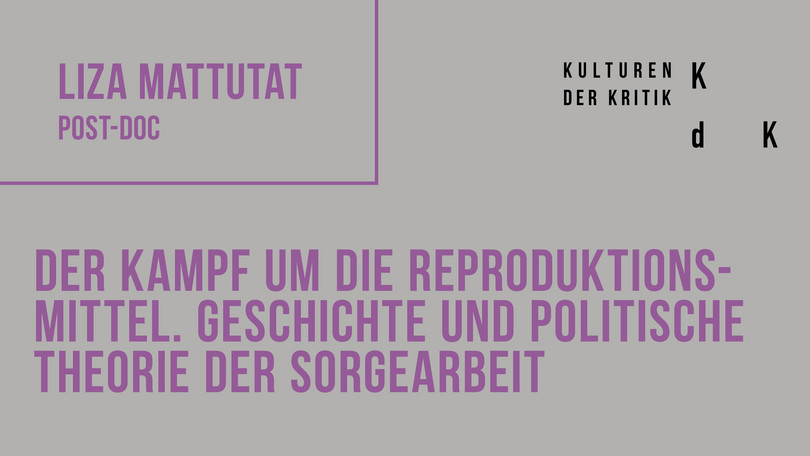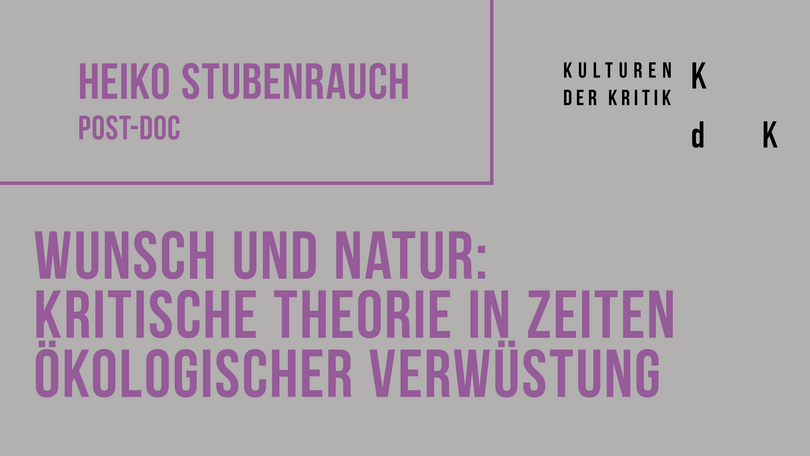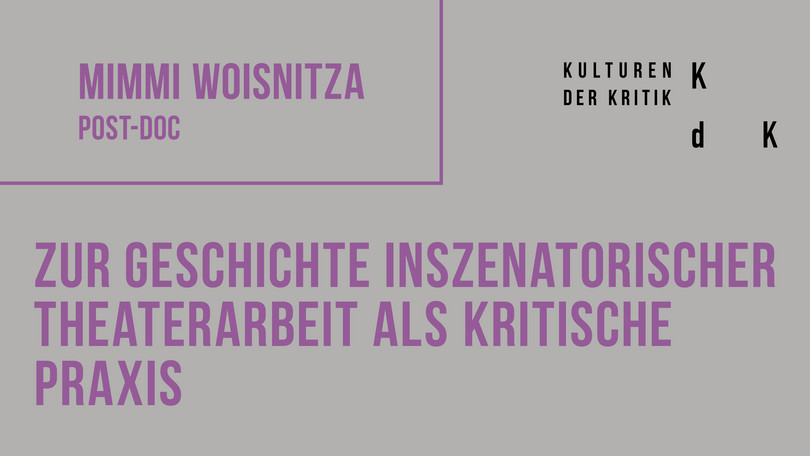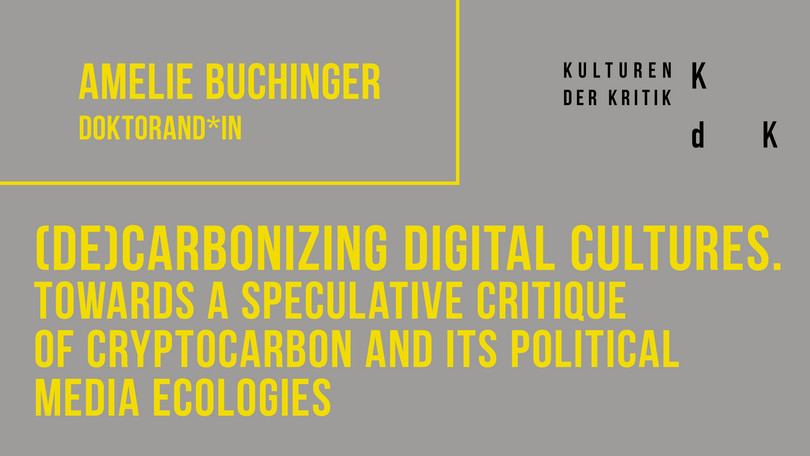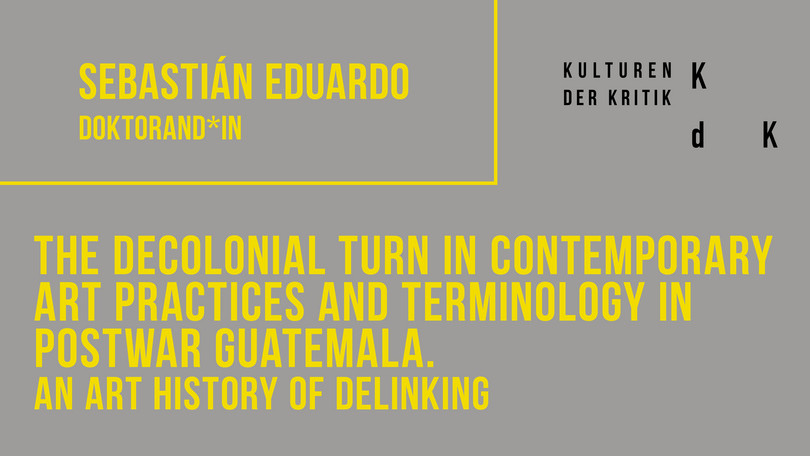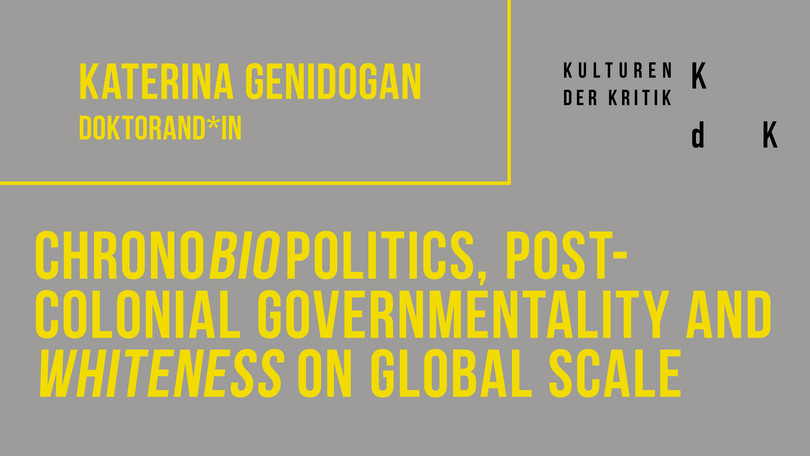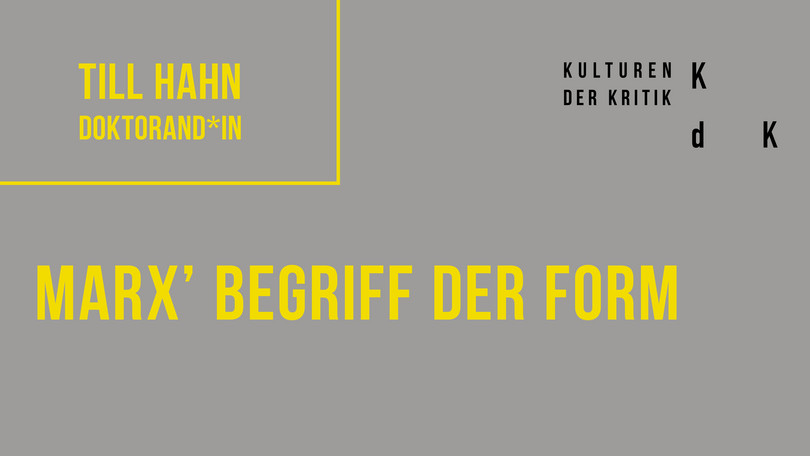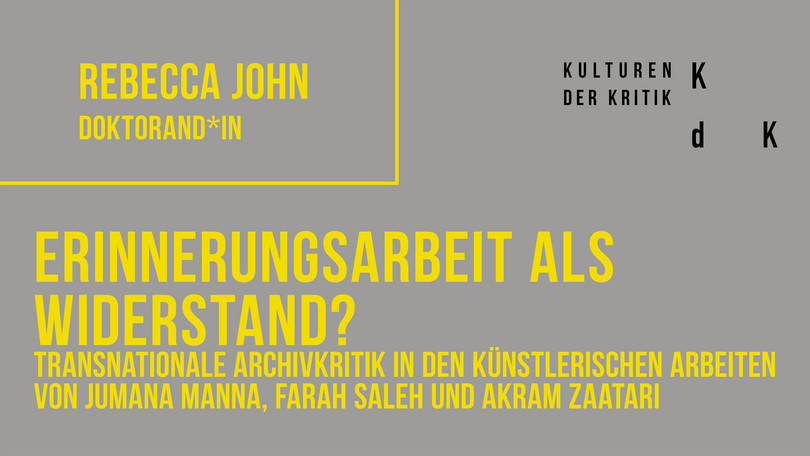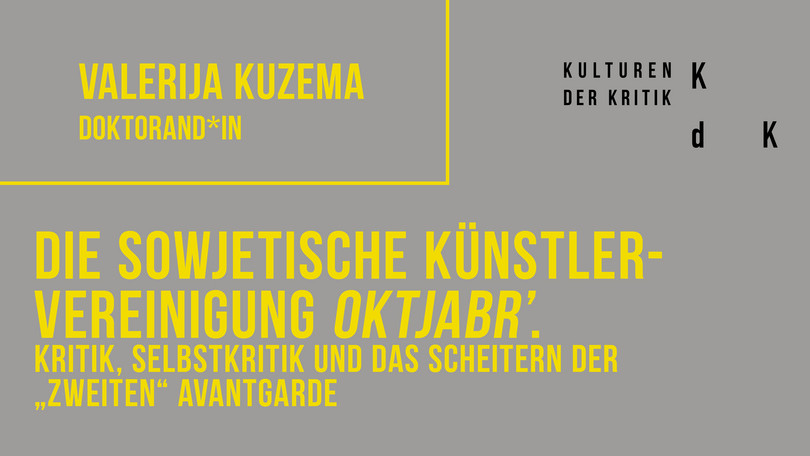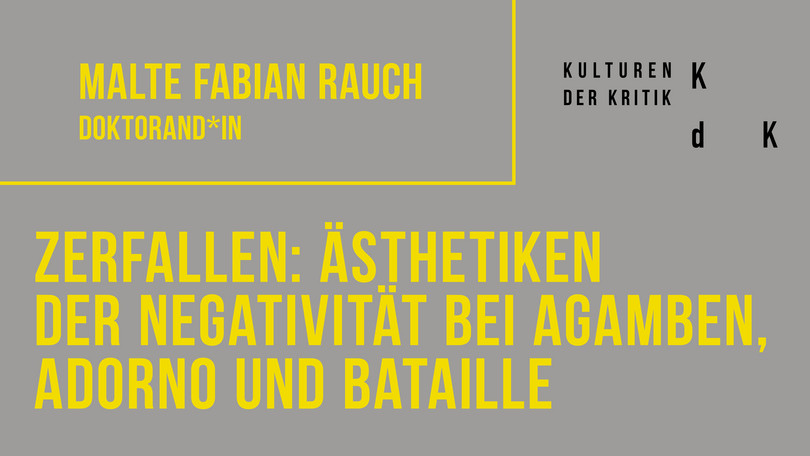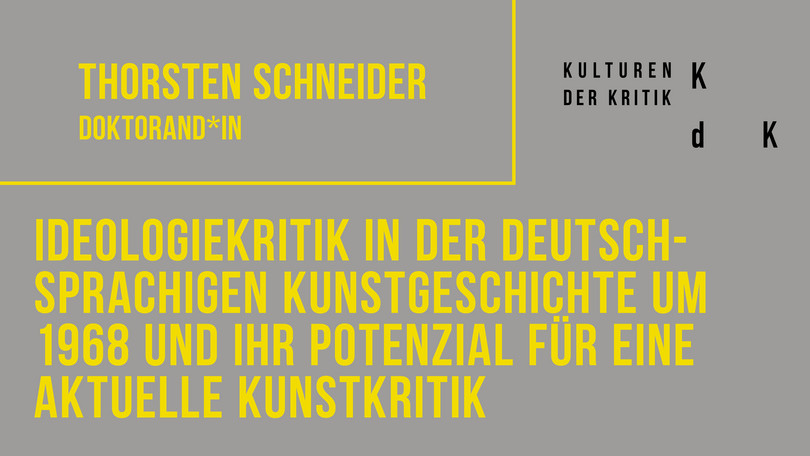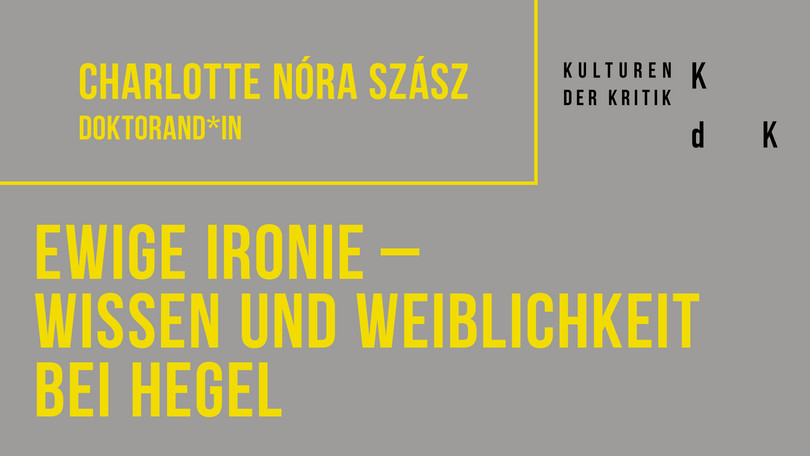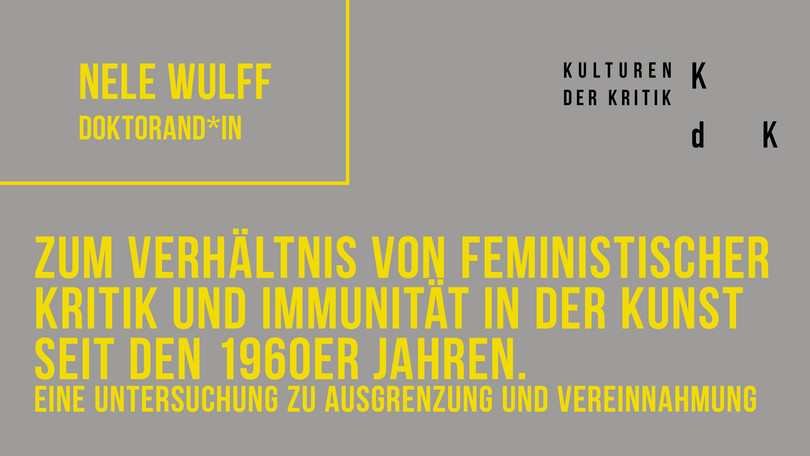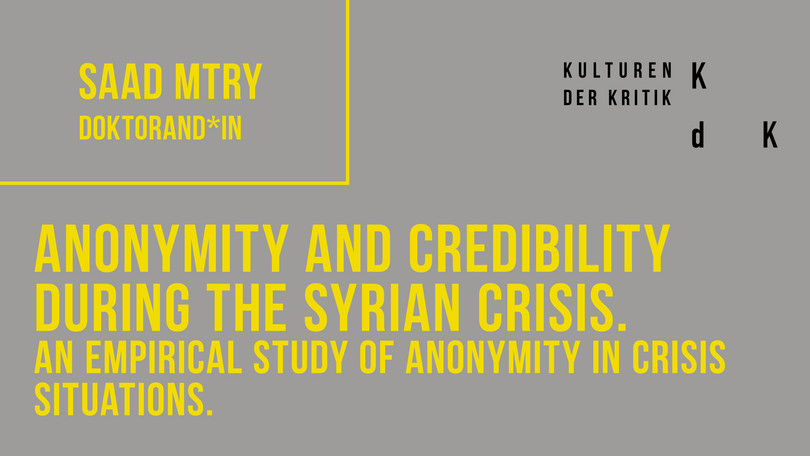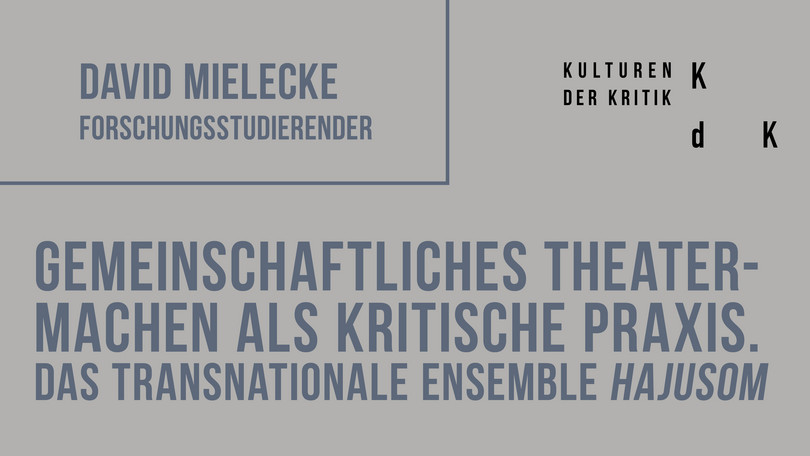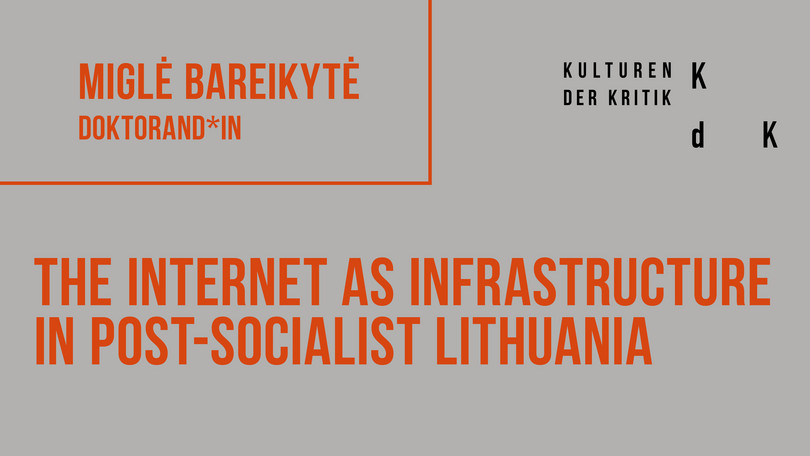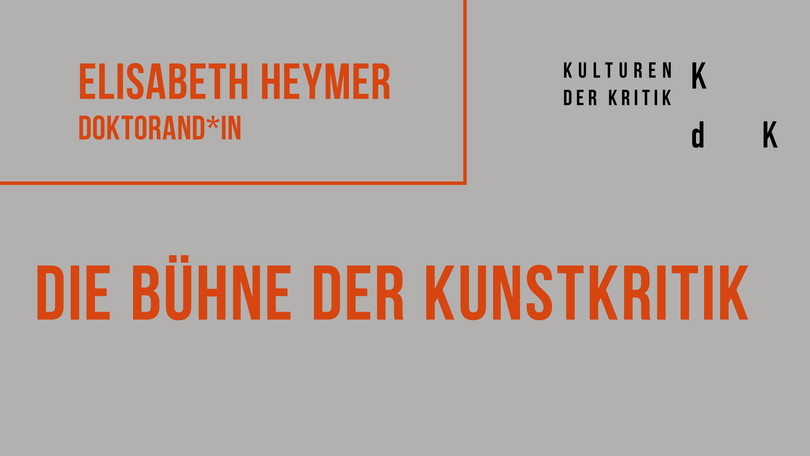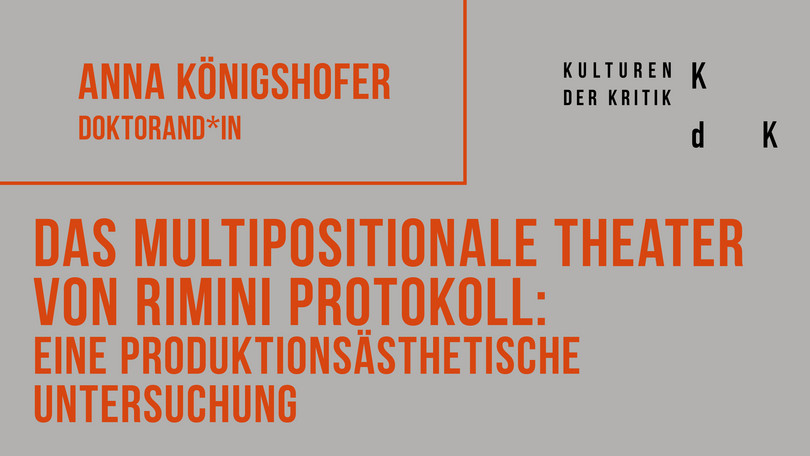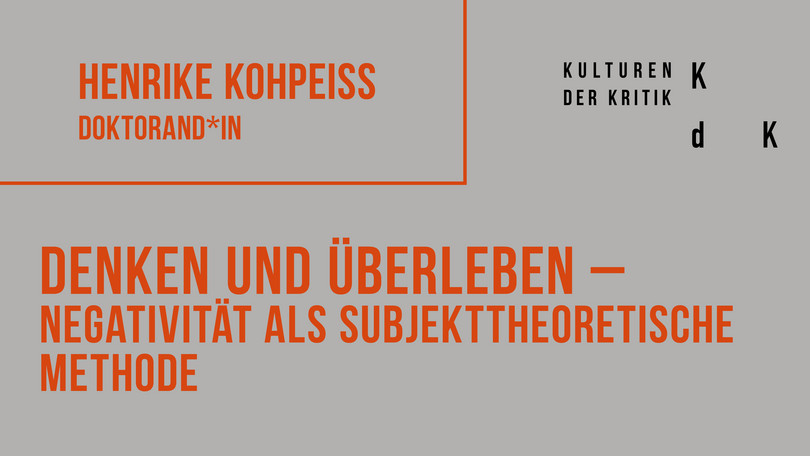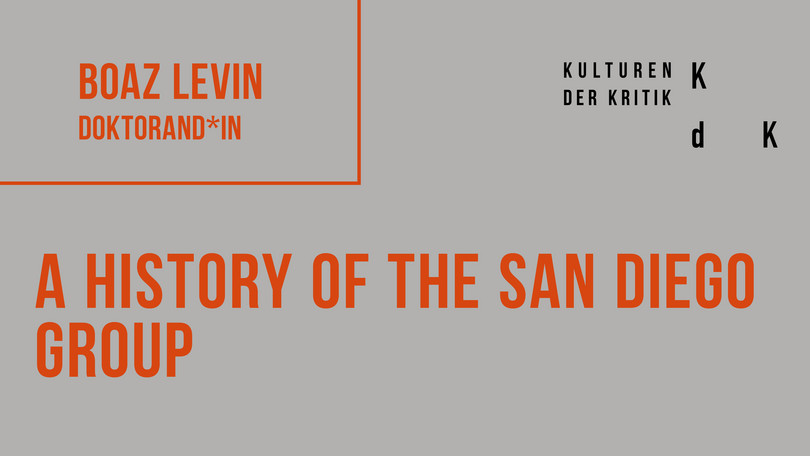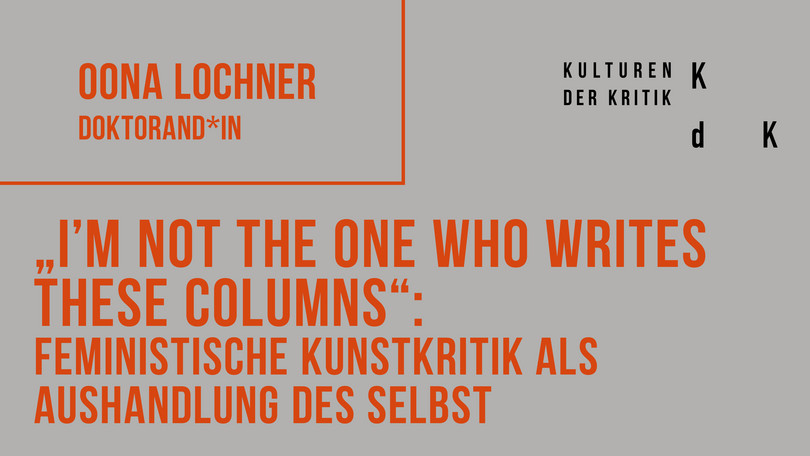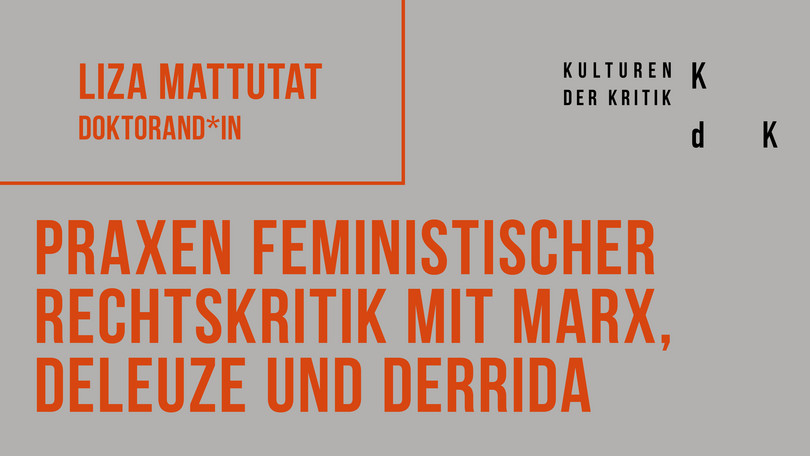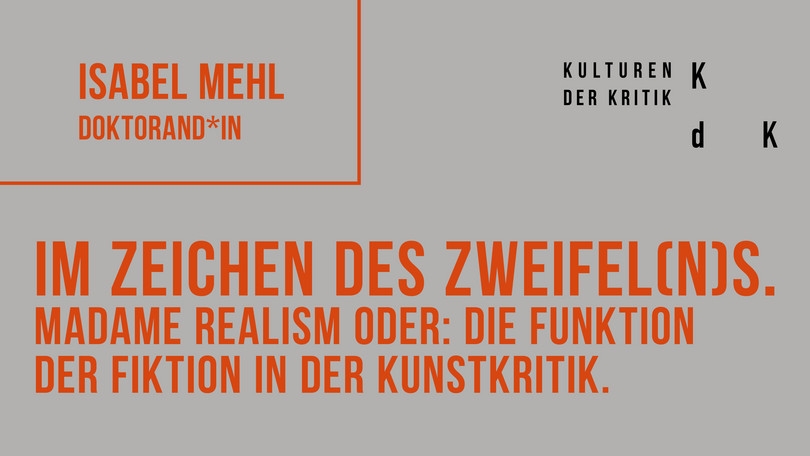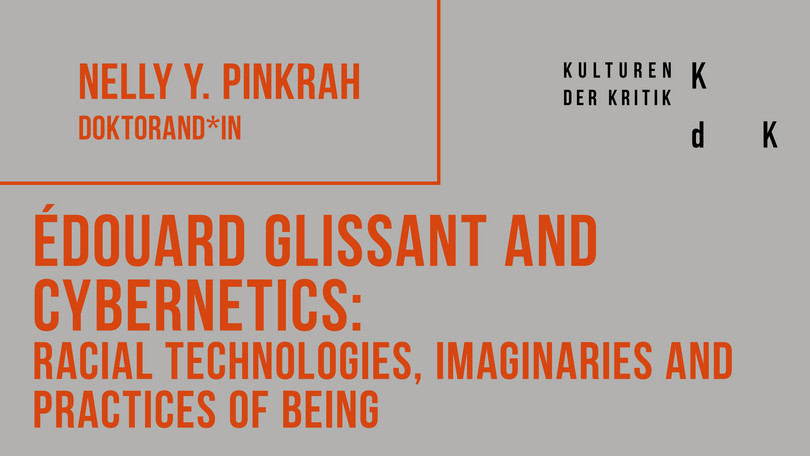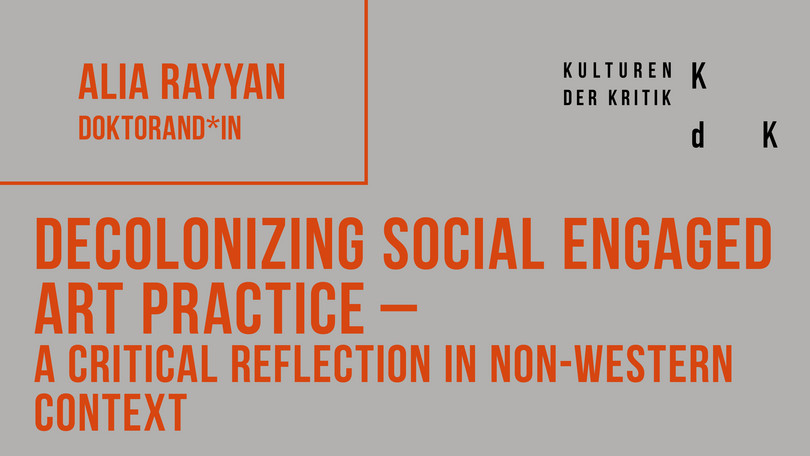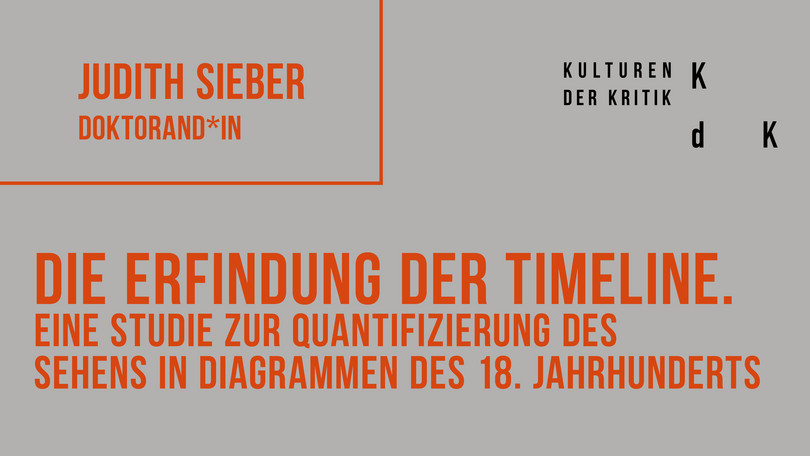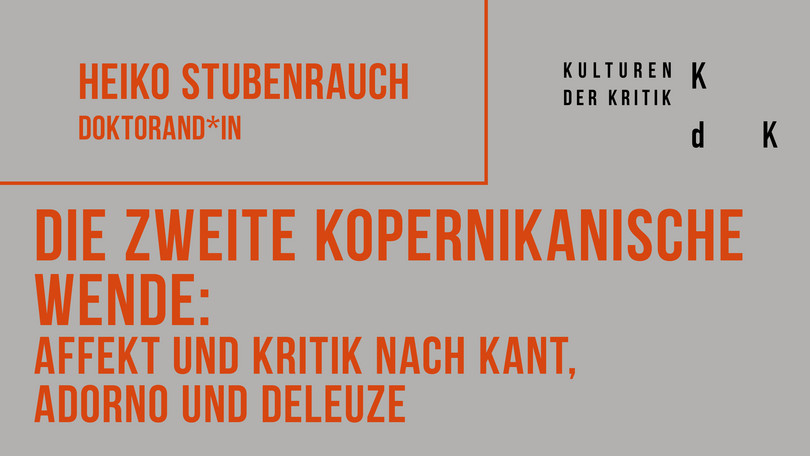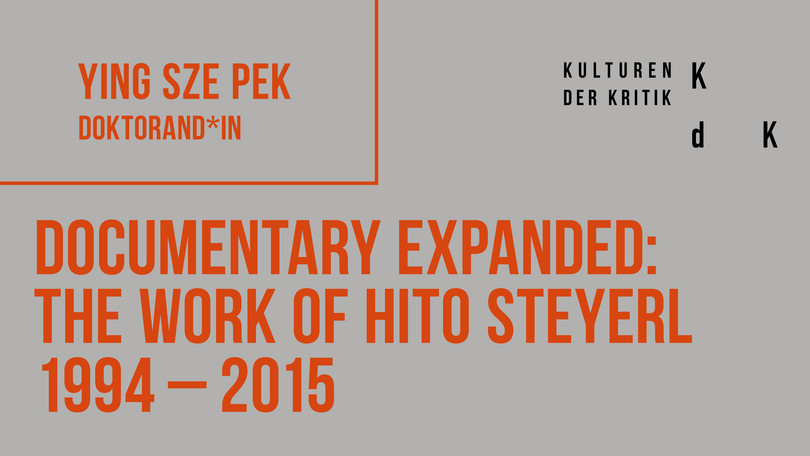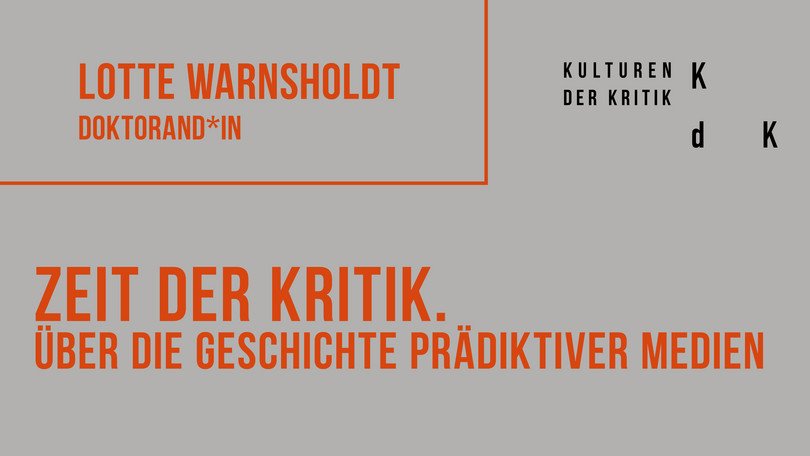Kulturen der Kritik
Graduiertenkolleg (DFG-GRK 2114)
Das Graduiertenkolleg „Kulturen der Kritik“ hat mit der Abschlussveranstaltung am 19. Juni 2025 THEORY IN/AS PRACTICE – PRACTICE IN/AS THEORY. CELEBRATING CULTURES OF CRITIQUE seinen Abschied zelebriert. Doktorand*innen aus allen drei Generationen haben in kurzen Vorträgen über das Verhältnis von Theorie und Praxis in ihrer Forschung reflektiert. Ein Panel mit internationalen Gästen, die auch als Mercator Fellows dem Kolleg verbunden waren, hat die Zukunft der Universität diskutiert.
Das Kolleg, das am 1. Oktober 2016 seine Arbeit aufgenommen hat, endete zum 30. September 2025. Es untersuchte anhand konkreter Fälle der Kunst-, Medien- und Sozialkritik den Zusammenhang von Kritik und Kultur in der Geschichte der Moderne bis zur Gegenwart. Ziel war es, diesen Zusammenhang neu zu erfassen und ein aktualisiertes, kulturwissenschaftlich fundiertes Kritikverständnis zu entwickeln.
In den neun Jahren gemeinsamer Forschung hat sich unser Programm auf kritische Praktiken konzentriert und deren Instanzen, Subjekte, Rahmenbedingungen, Geltungsansprüche und Wirkungsweisen sowohl in ihren spezifischen Situiertheiten als auch in ihren globalen Verflechtungen analysiert.
Unsere Forschung hat gezeigt, dass kritische Praktiken nicht von den Formen und Medien ihrer Darstellung getrennt werden können; diese konstituieren den Gegenstand der Kritik und prägen deren gesellschaftliche Wirkungen. Post- und dekoloniale sowie transkulturelle Perspektiven haben grundlegende, in der Aufklärung wurzelnde Annahmen über Kritik in Frage gestellt, gerade auch auf Basis des Befundes, dass theoretische Modellierungen sich häufig aus intervenierenden, protestierenden Praktiken heraus entwickelt haben. Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis hat das Kolleg in der gesamten Laufzeit beschäftigt.
Wir danken allen Akteur*innen des Graduiertenkollegs „Kulturen der Kritik“ für die inspirierende und verlässliche Zusammenarbeit, für Unterstützung und Anregung. Unser ganz besonderer Dank gilt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die die finanzielle Grundlage geschaffen hat.
Aktuelles
Melcher Ruhkopf mit Förderpreis Maritimes Kulturerbe ausgezeichnet
Für seine Dissertation „Das Logistische Museum. Museen des Seehandels als Infrastrukturen der Kritik“ wurde unser Kollegiat Melcher Ruhkopf mit dem Förderpreis Maritimes Kulturerbe des Deutschen Schifffahrtsmuseums/Leibnitz-Institut für Maritime Geschichte ausgezeichnet. Der mit 5000 € dotierte Preis würdigt herausragende Dissertationen, die sich mit maritimen Themen auseinandersetzen und Geschichte und Gegenwart miteinander verbinden. Die Preisverleihung findet am 5.9.2025 im Rahmen des Festakts zum 50. Jubiläum des Museums in Bremerhaven statt. Wir gratulieren von Herzen!
CFP: Lebenswelten schaffen: Künste im Gebrauch
Berlin, 6.–8.11.2025
Eingabeschluss: 30.04.2025
DFG-Sonderforschungsbereich Intervenierende Künste (Freie Universität Berlin / Leuphana Universität Lüneburg) & Brücke-Museum, Berlin
Die Tagung widmet sich der dynamischen Beziehung zwischen sogenannte „angewandter“ und „freier“ Kunst im frühen 20. Jahrhundert. Es formierten sich international künstlerische Bewegungen, welche die Kunst in den Alltag integrierten und die Grenzen zwischen Kunst und Leben auflösen wollten. Ausgehend von der Arts-and- Crafts-Bewegung in Großbritannien und der Werkbund-Debatte in Deutschland wurde in diesem Zuge das Kunsthandwerk um- und aufgewertet zu einer genuin künstlerischen Praxis.
Auch in gegenwärtigen Kunstdiskursen finden wieder verstärkt Diskussionen um das Kunsthandwerk statt, die sich, aus verschiedenen Perspektiven, entschieden gegen Hierarchisierungen wenden, wie u.a. die jüngste Biennale di Venezia, nicht zuletzt durch die Weitung des Blicks über europäische und US-amerikanische Horizonte hinaus. Theoretische Auseinandersetzungen wie etwa die “Craft Theory” grenzen sich wiederum von dezidiert künstlerischen Praktiken, vom Kunstbegriff und von der Zuordnung zur “High Art” ab und fordern einen eigenständigen Bereich.
Die meisten avantgardistischen Bewegungen im frühen 20. Jahrhundert fokussierten in ihren Entwürfen für Gebrauchsgegenstände ebenfalls das Verhältnis von Form und Funktion, um auf diese Weise gestaltend in die Lebenswelt einzugreifen. Die Tagung hingegen nimmt Künstler*innen und Gruppierungen in den Blick, deren Arbeiten auch in angewandten Bereichen einem emphatischen Kunstbegriff verpflichtet blieben. Daher schlagen wir die Formulierung “Künste im Gebrauch” vor. Diese gestalterischen Praktiken positionierten sich an der Schnittstelle zwischen “freier” und “angewandter” Kunst und wurden, wie das Kunsthandwerk insgesamt, auch aufgrund ihrer uneindeutigen Position in der kunsthistorischen Forschung wenig berücksichtigt.
Künstler*innen des Jugendstils oder der Wiener Werkstätten, die Mitglieder der „Brücke“, des „Blauen Reiter“, der „Nabis“, der Bloomsbury Group, aber auch einzelne Künstler*innen wie Pablo Picasso oder Gustav Klimt beschäftigten sich intensiv mit dem “Kunsthandwerk”. Allen gemeinsam ist die Betonung einer künstlerischen Ausrichtung der Gestaltung, die nicht auf Funktionalität orientiert ist. Die Arbeiten waren auch nicht für serielle Fertigung bestimmt und sind daher abzugrenzen vom Bauhaus und von jenen Strömungen, die in das (Industrial) Design etc. münden. Formen, Medien und Motivationen unterscheiden sich indes bei den Künsten im Gebrauch. Auffällig ist die Vielfalt an Genres und Medien, von Textilien und Möbelbau über Keramik bis hin zu Schmuck, Gebrauchsgrafik, Bühnenbildern und Kostümen. Die meisten dieser Arbeiten operierten über etablierte Gattungsgrenzen hinweg.
Die Tagung untersucht die Wechselwirkungen zwischen den Feldern “hohe” und “angewandte” Kunst, die sich um 1900 zu verschleifen begannen. Im Zentrum steht die wechselseitige Annäherung der Praktiken und Diskurse.
Zentrale Fragen lauten: Welche Formen, Medien, Materialien wandern um 1900 zwischen den beiden Bereichen der “angewandten” und der “freien” Kunst und welche diskursiven Verschleifungen gibt es in der Rede über diese Produkte? Wo lernten die Künstler*innen mit Holz, Ton, Metall oder Textilien umzugehen? Und was interessierte sie an dem Umgang mit diesen Materialien? Stammen Entwurf und Ausführung aus einer Hand? Und welche Bedeutung ergibt sich daraus für das Werk? Welche Rolle spielten soziale und ökonomische Bedingungen für die Produktion von Künsten im Gebrauch zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Welche Netzwerke und Diskurse prägten das Verhältnis der Künstler*innen wie der Sammler*innen und Mäzen*innen zu den Künsten im Gebrauch? Gab es programmatische Stellungnahmen, etwa zur Einheit der Künste oder zur Verschleifung von Kunst und Leben? Mit welchen künstlerischen Strategien wurde diese im jeweiligen Gebrauchszusammenhang umzusetzen versucht? In welcher Weise leisteten die Künste im Gebrauch einen Beitrag zu ästhetischen oder gesellschaftlichen Veränderungen?
Ziel der Tagung ist es, den Nexus von Produktionsbedingungen, ästhetischen Strategien und angestrebten Wirkungsweisen in diesem Grenzbereich zu beleuchten. Die Tagung findet in Berlin statt und wird veranstaltet vom DFG-Sonderforschungsbereich Intervenierende Künste (Freie Universität Berlin, SFB 1512, TP A06: Künstlerische Lebensform als Intervention, PI: Beate Söntgen, Leuphana Universität) in Kooperation mit dem Brücke-Museum, Berlin (Lisa Marei Schmidt, Direktorin).
Entlang von drei geplanten Panels können folgende Aspekte thematisiert werden:
Wohnwelten: Gestaltung von Möbeln, Textilien, ganzen Wohnräumen; raumbezogene dekorative Malerei.
Arbeitswelten: Ökonomische und künstlerische Produktionsbedingungen; Erlernen kunsthandwerklicher Fertigkeiten; Arbeitsteilung; Ateliersituationen.
Beziehungswelten: Künste im Gebrauch, wie etwa Schmuck oder Textilien, als beziehungsstiftendes Tauschobjekt; Auftragsarbeiten für Sammler*innen, Mäzen*innen; Gebrauchsgrafik als netzwerkbildendes Kommunikationsmedium.
Die deutschsprachige Tagung strebt eine inter- und transdisziplinäre Perspektive an und begrüßt Beiträge aus Kunst-, Design-, Theater- und Kulturwissenschaften, aus der Soziologie und den Wirtschaftswissenschaften sowie aus der Entwurfs- und kuratorischen Praxis. Reisekosten und Unterkunft werden gemäß des Bundesreisekostengesetzes erstattet. Wir erbitten Abstracts zu Fallstudien und/oder zu theoretischen Überlegungen. Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 2.500 Zeichen) bis zum 30. April 2025 an Hanna Schwarzenberg (hanna.schwarzenberg@leuphana.de). Die Vorträge sollen 20 Minuten umfassen. Eine schriftliche Skizze (5-6 Seiten) soll drei Wochen vor der Tagung unter den Beitragenden zirkulieren. Die Tagung wird vom 6.-8. November 2025 in Berlin stattfinden. Die Manuskripte (25.000 Zeichen und maximal 8 Abbildungen) für die geplante Publikation werden bis 15. Dezember 2025 erbeten.
Duke University – Leuphana University Gender, Queer and Transgender Studies Workshop für Doktorand*innen
Professor Ben Trott (Leuphana Universität Lüneburg) und Professor Gabriel Rosenberg (Duke University) haben für diejenigen Doktorand*innen der Geisteswissenschaften beider Universitäten, die sich mit Fragen von Geschlecht und Sexualität beschäftigen, einen „Gender, Queer and Transgender Studies Workshop“ organisiert. Ziel des Workshops ist es, die Promovierenden bei der Ausarbeitung ihrer Dissertationen zu unterstützen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit einem internationalen wissenschaftlichen Publikum zu präsentieren, den Zugang zu wichtigen internationalen Archiven zu ermöglichen und internationale Netzwerke und wissenschaftlichen Austausch zwischen Fakultätsmitgliedern und Doktorand*innen zu fördern und zu festigen.
In einem ersten Schritt haben fünf Doktorand*innen der Leuphana Universität Lüneburg im März 2024 die Duke University besucht, wo sie gemeinsam mit drei Doktorand*innen der Duke University und einem Doktoranden des Global History Programms der Freien Universität Berlin an einem zweitägigen Workshop teilnahmen. An dem Workshop nahm auch Dr. Zavier Nunn, Postdoktorand der „Histories of the Transgender Present“ an der Duke University, teil. Die neun Doktorand*innen stellten jeweils eines ihrer Dissertationskapitel (oder einen anderen Teil ihrer Arbeit) in einem 20-minütigen Vortrag vor, auf den eine zehnminütige kritische Respondenz folgte. Im weiteren Verlauf des Austauschprogramms sollen die Teilnehmer*innen ihre Vorträge zu einem Kapitelentwurf oder einem Zeitschriftaufsatz ausarbeiten und in Lüneburg während eines zweiten Workshops im Juni zur Diskussion stellen. Dabei soll es erneut Raum für kritisches Feedback und die Erarbeitung von Weiterentwicklungsvorschlägen geben.
Prof. Trott ist Gastprofessor am Institut für Philosophie und Kunstwissenschaft (IPK) an der Fakultät Kulturwissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg, Sprecher des Center for Critical Studies (CCS) und Co-Sprecher des Forschungsnetzwerkes Geschlechter- und Diversitätsforschung. Prof. Rosenberg ist Associate Professor für Gender, Sexuality and Feminist Studies sowie für Geschichte an der Duke University (Durham, NC, USA). Dr. Nunn ist Postdoctoral Associate der Histories of the Transgender Present an der Duke University. Im Sommer 2024 tritt er ein Mellon-Stipendium bei der Society of Fellows in the Humanities an der Columbia University (NY, USA) an.
Die Kollegiat*innen stellen sich vor
Projekte der dritten Generation
Wir freuen uns sehr, die dritte Generation Doktorand*innen bei Kulturen der Kritik begrüßen zu dürfen! Dreizehn neue Mitarbeit*innen haben im Wintersemester 2022/2023 die Arbeit aufgenommen und leisten mit ihren Projekten wichtige Beiträge zur Aktualisierung eines kulturwissenschaftlichen Kritikbegriffs.
- Kelly Bescherer: ‚Identitätsklärung‘ als umstrittene Kontrollpraxis im deutsch-europäischen Abschieberegime
- Jan-Hauke Branding: "Sagen was wir sind" - Die Theoriebildung der radikalen Schwulenbewegung als (Konstellation der) Kritik
- David Cabrera Rueda: A museum of memory for Colombia: The emergence of a controversial space
- Raphael Daibert: Den Himmel anheben – Praktiken zu einem alternativen Erhalt der Welten
- Volha Davydzik: Wiederaufbau von Solidarität und Care-Netzwerken durch Kunst: Politische künstlerische Praktiken in Rebellischen Gesellschaften
- Felix Leonhard Esch: Die Dialektik des Body Politic: Eine Studie zum Wandel des neuzeitlich sozialen Körpers
- Jörg Hügel: Urkommunismus als narratives Konzept zwischen 1848 und 1940
- Dyoniz Kindata: Deutsche und suahelische Kolonialzeitungen in Deutsch-Ostafrika 1885-1918 als multimodale Orte der Herausbildung von sozialem Wissen und Kulturen der Kritik
- Stasya Korotkova: Cross-Dressing und Queerness im Film des Russischen Kaiserreiches
- Melcher Ruhkopf: Das Logistische Museum - Maritime Museen und Hafenmuseen als potenzielle Räume der Kritik
- Laura Felicitas Sabel: Praktiken des Transitorischen: Restitution und Museumspraxis anhand des (im)materiellen Kulturerbe der Nachfahren der Tairona der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien
- Donovan Stewart: Die ökotechnische Gemeinschaft: zum Problem der (Re-)Organisation des politischen Ortes
- Lukas Stolz: Facing Reality: Between Doom and Cruel Optimism
- Julian Volz: ‚Alger la Blanche‘ wird ‚Alger la Rouge‘ – Zum Erbe des antikolonialen Aufbruchs in der Gegenwartskunst