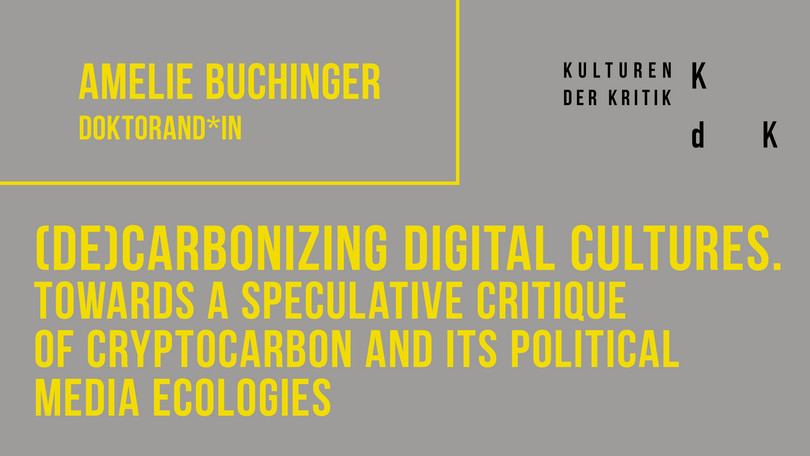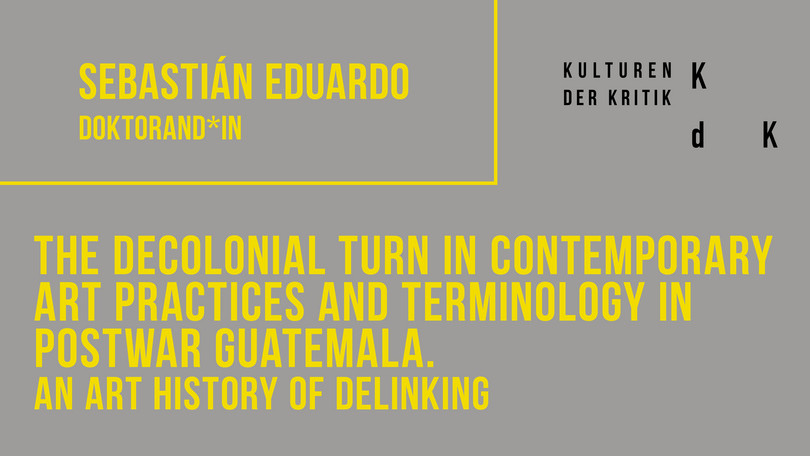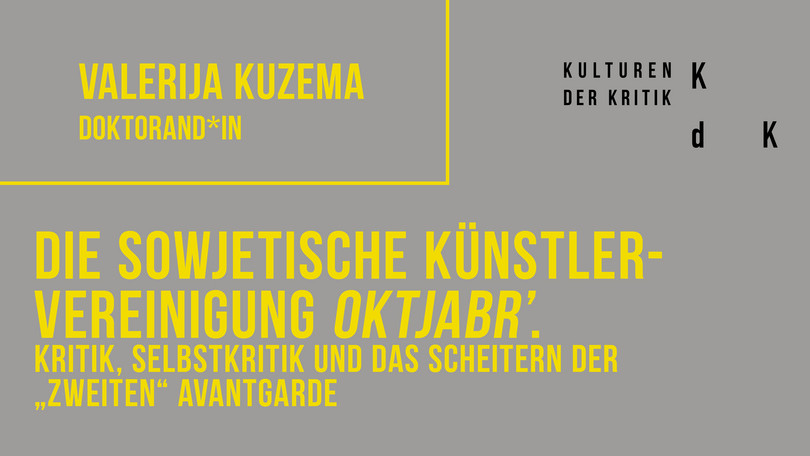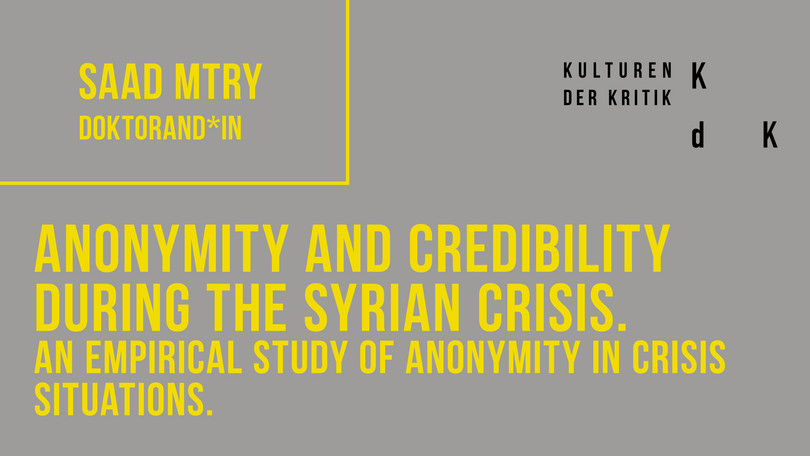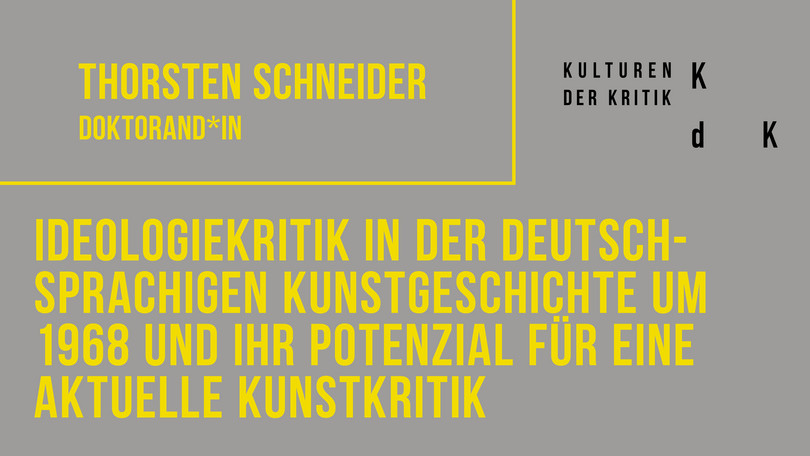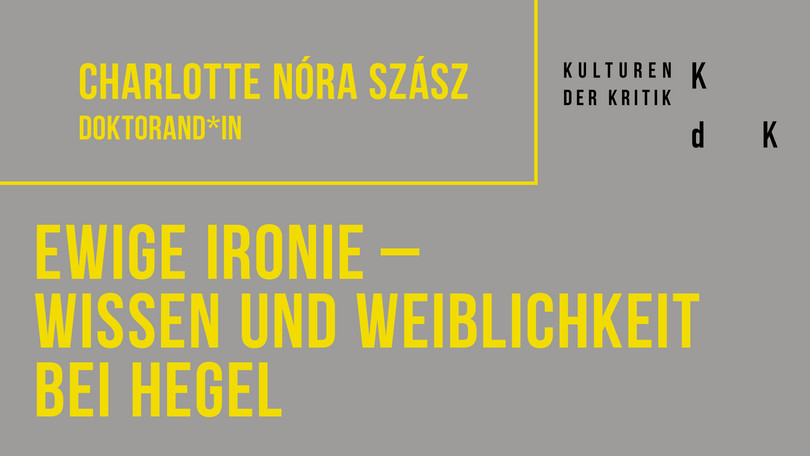Amelie Buchinger
The dissertation project examines the role digital cultures and technologies play in current processes of (de)carbonization. It investigates cryptocarbon platforms as media assemblages of digital (de)carbonization that (re)mediate carbon as a central medium of climate change. To do so, it traces the political media ecologies of recent initiatives that deploy AI and blockchain technologies in the field of carbon sequestration and storage. It tentatively refers to these projects as cryptocarbon, following a term proposed by the geographer Peter Howson. [1]
My research aims at providing a media cultural analysis of cryptocarbon on three levels: First, it analyzes cryptocarbon platforms as part of a larger set of media assemblages that not only incentivize carbon removal practices but rather redefine the socio-cultural dimension of carbon as a key mediating metric of climate change and its mitigation. Secondly, it investigates possible techno-political implications of cryptocarbon as a potential novel regime of remote algorithmic carbon governance. Finally, in situating the dissertation’s research within the geophysical climate realities of accumulating atmospheric C02, it aims at questioning the potential of appropriating these technologies for critical practices of decarbonization and techno-ecologies of reparation.
In doing so, this dissertation project not only aims to provide a much needed but nuanced critique of cryptocarbon and digital (de)carbonization as a speculative proposition. Furthermore, the project takes such a critical analysis as its starting point to question the possibilities, forms, and limits of critical practices under current technological, economic, and ecological conditions and their concomitant implications on human and more-than-human life worlds in a warming world of rising atmospheric CO2 levels. It proposes to rethink decarbonization beyond techno-utopian solutionism or environmental romanticism as a critical practice of envisioning and constituting a plurality of possible post-carbon futures.
[1] Howson, Peter, Sarah Oakes, Zachary Baynham-Herd, and Jon Swords. “Cryptocarbon: The Promises and Pitfalls of Forest Protection on a Blockchain.” Geoforum, no. 100 (2019): 1–9.
Sebastián Eduardo
Seit einigen Jahren beschäftigen sich Theoretiker*innen der Dekolonialität in ihrer Analyse und Kritik der Modernität auch mit Kunst und Ästhetik/Aisthesis. Ihre Texte wurden zu Bezugspunkten für das Reden und Schreiben über Kunst sowie für künstlerische Praktiken. In Guatemala verwenden insbesondere Maya-Künstler*innen verstärkt seit 2012 entweder selbst Begriffe wie die „koloniale Wunde“ (Mignolo 2005), oder sie werden mit diesen, ob gewollt oder nicht, in Verbindung gebracht. Theorien der Dekolonialität bedeuten für diese Künstler*innen einerseits einen Zugang zur übernationalen Gegenwartskunstsphäre. Andererseits gehen sie dabei auf unterschiedlicher Weise der zentralen Forderung nach Entkoppelung (delinking) von der Modernität/Kolonialität nach. Ist Gegenwartskunst ohne Modernität allerdings nicht zu denken, entsteht ein Spannungsverhältnis, das auszuloten ein Ziel des Dissertationsvorhabens ist.
Das Dissertationsprojekt untersucht partikulare Formen, Strategien und Medien in künstlerischen und sensorischen Praktiken sowie in Praktiken des Wissens, des Redens und Schreibens über Kunst vor und nach der „dekolonialen Wende“ in Guatemala der Postkriegszeit, das heißt seit 1996. Vor dem Hintergrund (selbst-)kritischer, postkolonialer Kunstgeschichten und Theorien der Indigenität, durch die Analyse von Praktiken und Theorien der Dekolonialität und anhand eines Wissenskorpus’ über Maya-Identität, (Post-)Kriegsgeschichte und guatemaltekische Gegenwartskunst geht es mir mit dem Dissertationsvorhaben um eine Kunstgeschichte der Entkoppelung.
Dekoloniale Entkoppelung ist dabei eine radikale Strategie der Kritik, die eine Standortverschiebung des kritisierenden Subjektes und damit eine neue Subjektivitätsform der Kritik voraussetzt. Sie zielt auf eine Wieder-Verkopplung (re-linking) mit Weltanschauungen, Prinzipien und Praktiken abseits des modern/kolonialen Paradigmas. Die damit einhergehende Distanzierung von Critical Studies und vom Kritikbegriff überhaupt muss zunächst ernst genommen werden, um die (Kunst-)Praktiken in Guatemala als anders geartete kritische Praxis verstehen und in ihrem Spannungsverhältnis zu einem modernen, ehemals westlichen Kritikbegriff untersucht werden zu können.
Mignolo 2005: Walter D. Mignolo, The Idea of Latin America, Oxford 2005.
Katerina Genidogan
My project explores how temporal and structural norms like causality, sequence, forward-moving agency, and operative logics like deterrence and preemption, generate governance through acts of silencing the past, erasing the present and speculating about the future. Following a method of archaeology, and a transhistorical perspective, I analyse how and with what ramifications, time entered science in the Victorian era, taking into consideration the shift in focus in the late 18th and 19th centuries from quantity and timeless laws to change, growth, evolution, a change that occurred almost simultaneously in physics (thermodynamics), biology (evolution), and astronomy (evolution of the solar system). In this context that was decisive for modernity, I aim to look at the relationship between evolution and linear, asymmetrical time through the work of Victorian social evolutionists, and showcase how their main belief that all societies proceed teleologically from savagery to barbarism to civilisation in a universally same process of unfolding, reconfigured race in the 19th century. My purpose here is to eventually suggest an epistemological shift in our understanding of race, whereby race is a product of processes of spatialization [through the connection of place (continent) of ‘origin’, bodies, and forms of consciousness] and temporalization (the positioning of this triptych in unilinear, universal time). Understanding, therefore, the ramifications of the radical naturalization of Time (e.g. dehistoricization of time) that was central to the most scientific achievements of the 19th century, is crucial in order to look at the “civilising mission” and, later, “development” projects as material entanglements of political and scientific practices that operate through the promise and the deferral, of coevalness that was initially denied. In this context and taking into consideration how the West has institutionalised and disseminated its own images of progress and future, I analyse the politics of synchronization in the “development”/upward progression era, looking at the Point Four Program, modernization theory and practice, and the politics of adaptation in the survival/downward progression era looking at projects such as the Adaptation and Resilience Action Plan by World Bank, and various strategies that call for the mainstreaming of disaster risk management into poverty reduction and development.
Till Hahn
Mein Promotionsprojekt soll eine umfassende Untersuchung des Formbegriffes, wie Karl Marx ihn in seinem ökonomiekritschen Spätwerk impliziert, leisten. Die Arbeit folgt dabei der These, dass Marx Form als gesellschaftliche Praxis versteht. Die Deduktion dieses Formbegriffes soll durch eine detaillierte Lektüre des ökonomiekritischen Spätwerkes Marxens geschehen. Die Methode ist dabei an Althussers Idee einer "Symptomalen Lektüre" angelehnt, d.h. es soll darum gehen im Marxschen Urtext den implizit notwendigen, aber nicht explizit definierten Formbegriff zu freizulegen.
In philosophischer Hinsicht schreibt sich mein Promotionsprojekt in die anhaltenden Debatten um einen neuen Begriff von Materialismus ein, in politischer Hinsicht soll es eine Fundamentalkritik der gegenwärtigen Transformationsprozesse des Kapitalismus ermöglichen. Marx geht es dabei – im unterschied zum gegenwärtigen "neuen" Materialismus – nicht darum, innerhalb des Dualismus von Materie und Form wieder zur Materie zurückzukehren, sondern diesen Dualismus selbst zu überwinden. Er will zeigen, dass dieser Dualismus selbst Ergebnis eines materiellen Gesellschaftsprozesses ist, innerhalb dessen die konkreten Produkte menschlicher Arbeit den Produzenten als abstrakte Formen zurückgespiegelt werden. Eine Untersuchung des Formbegriffes ermöglicht daher eine Kritik der "Ideologien der Materialität", derjenigen gesellschaftlichen Prozesse also, die zwischen materiell und immateriell, emprisch und transzendental unterscheiden. Politisch knüpft dieses Projekt damit an die Debatten um die Transformationen des Kapitalismus im sogenannten "post-industriellen" Zeitalter an: Meine Untersuchung würde eine qualifizierte Kritik von gegenwärtigen Produktionsverhältnissen ermöglichen, indem sie die Materialität von prima facie immateriellen Produkten wie Dienstleistungen, Daten usw. aufzeigt.
Rebecca John
Erinnern, Sammeln und Archivieren sind prominente Themen der Gegenwartskunst seit den 1990er Jahren. Okwui Enwezors Ausstellung Archive Fever – Uses of the Document in Contemporary Art von 2008, die auf Jacques Derridas gleichnamigen Text zum Archiv bezugnahm, kann ebenso wie die Begriffe „memory boom“ (Erll 2017) und „archival impulse“ (Forster 2004) dem so genannten archival turn zugerechnet werden. Diese bisher meist auf Europa und Nordamerika bezogene Wende soll in meinem Dissertationsprojekt mit Methoden der globalen Kunstgeschichte betrachtet werden. Dabei gehe ich von der Annahme aus, dass mit den räumlichen Bezugspunkten der künstlerischen Arbeiten auch bestimmte Aspekte des „archival impulse“ verknüpft sind, die Autoren wie Hal Foster außer Acht ließen.
Der Fokus meiner Arbeit liegt auf künstlerischer Archivkritik, welche in Auseinandersetzung mit Krisen- und Kriegssituationen in Libanon und Palästina/Israel die Produktion kultureller Identität thematisieren und dabei eine grenzüberschreitende Geschichte der Region erzählen. Anhand einer Analyse und regionalspezifischen Kontextualisierung ausgewählter Arbeiten von Jumana Manna, Akram Zaatari und Farah Saleh soll das kritische Potential der Beschäftigung mit dem Archiv in der Kunst erörtert werden. Dabei möchte ich zeigen, wie vor dem Hintergrund von gescheiterter lokaler Erinnerungspolitik, nationaler Identitätskonstruktion und universalistischer Geschichtsschreibung durch Methode, Inhalt und Form der Archiv-Arbeiten verschiedene alternative Narrative hervorgebracht werden, z.B. durch Oral History, connected histories (Subrahmanyam 1997), positioniertes Wissen (Hall 1994) und situiertes Wissen (Haraway 1988).
Ulrike Jordan
In den 1960er und 70er Jahren wurde von einigen Künstler*innen (wieder) die gesellschaftliche Institution Fabrik als Ort künstlerischen Wirkens ausgemacht. Ihre Bezugnahmen auf diesen Ort könnten dabei unterschiedlicher nicht sein: sie reichten von interventionistischen Ansätzen im Sinne militanter Untersuchungen über ein rein technisches Interesse an industriellen Fertigungsmöglichkeiten bis hin zu dem Versuch, die künstlerische Praxis in direkten Kontakt mit anderen gesellschaftlichen Bereichen jenseits der üblichen Kunstinstitutionen zu bringen.
Die Verschiebung des künstlerischen Arbeitsprozesses aus dem Atelier in die Fabrik ist symptomatisch für das in dieser Zeit verstärkt auftretende Interesse an Kunstpraxen, bei denen vor allem die Handlung, das Prozessuale und die Arbeit im Kontext im Vordergrund steht. Aber nicht nur Diskussionen um konzeptuelle Praxen waren dabei von Bedeutung, auch war diese Verschiebung oftmals die Konsequenz eines verstärkten Nachdenkens über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft und einer kritischen Befragung der Funktionen, die der Kunst in Bezug auf den weiteren gesellschaftlichen Kontext zufallen. Im Rahmen meiner Dissertation werde ich diese Fabrikinterventionen historisch aufarbeiten und die künstlerisch wie politisch vielfältigen Ansätze kritisch evaluieren. Welche Grenzziehungen zwischen Kunst und Gesellschaft, zwischen Künstler*innen und Arbeiter*innen werden sichtbar? Welche (produktiven) Reibungsmomente - auch in Bezug auf unterschiedlich situiertes Wissen - entstanden in der Interaktion von Künstler*innen, Arbeiter*innen und Managmentetagen? Inwiefern lassen sich die Interventionen auch als eine Kritik an den Produktions- und Rezeptionsbedingungen der Kunst selbst verstehen? Die untersuchten Praxen müssen dabei einerseits zu jüngeren Diskussionen um sozial engagierte Kunst ins Verhältnis gesetzt und teils kritisch abgegrenzt werden. Zum anderen gilt es zu analysieren, inwiefern Diskussionen um die neoliberale Inkorporation von "Kreativität" in Wertschöpfungsketten für diese Praxen von Relevanz sind bzw. von ihnen quasi vorweggenommen wurden.
Valerija Kuzema
Das Promotionsvorhaben geht von der Hypothese aus, dass eine spezifische „Kritik und Selbstkritik“ wesentliche und prägende Komponente innerhalb der Transformationsprozesse in der Sowjetunion hin zu einem zentralisierten Kunstsystem im Frühstalinismus war. Es nimmt hierfür Programmatik und Wirken der sowjetischen Künstlervereinigung Oktjabr’ (1928–32) in den Fokus, der mehr als 250 Mitglieder angehörten, darunter führende Vertreter*innen und Kunsttheoretiker*innen der russischen Avantgarde, wie Aleksandr Rodčenko oder El Lissickij. Hinterfragt wird die in der bisherigen kunsthistorischen Forschung vertretene Annahme, der zufolge die russische, künstlerische Avantgarde Mitte der 1920er Jahre erloschen war. Dem entgegenlaufend stellt die Arbeit die Frage, inwiefern die Avantgarde ihre Aktivitäten im Modus der Kritik und Selbstkritik auch noch in den 1930er Jahren – wenn auch unter veränderten Kontextbedingungen – fortsetzte. Mithilfe einer kunsthistorischen Rekonstruktion und theoretischen Einordnung der Zielsetzungen und Tätigkeiten der sich aus verschiedenen Disziplinen und Medien speisenden Vereinigung soll nicht zuletzt die These überprüft werden, dass sich die künstlerische Avantgarde – und insbesondere die Gruppe Oktjabr’ – als Folge der sog. „Avantgardekritik“ und in Abgrenzung zu gegnerischen, im Akademismus arbeitenden Gruppierungen zum „Scharnier“ in Richtung einer staatlich gelenkten Kunst entwickelte.
Ferner dient die Gruppe Oktjabr’ der Arbeit als Prisma, um den Blick auf die vielfältigen und verwobenen Diskussionen und Ereignisse im sog. „Kampf der Richtungen“ in der Sowjetunion um 1930 zu schärfen, die sich unmittelbar vor der Verkündung des Dogmas des Sozialistischen Realismus als letzter Etappe der politischen Zentralisierung entfalteten. In dieser Periode konstituierte sich eine Öffentlichkeit sowie eine spezifische Form der Kunstkritik, die sich exemplarisch in zahlreichen Publikationsorganen abzeichnete und sich gleichfalls in einem gesellschaftlich geforderten Modus der Kritik und Selbstkritik vollzog.
Malte Fabian Rauch
Ohne dass sie je als Grundbegriffe der Ästhetik etabliert wurden, führen „Negation“ und „Negativität“ ein Eigenleben an der Schwelle zwischen den Disziplinen. Die Dissertation fragt nach der Historizität dieser Kategorien und nach der Möglichkeit einer aktuellen Bestimmung. Ihre These ist die Konvergenz von Negativität und Kritik. Hat sich die Diskussion um Negativität zunehmend auf die Opposition von Affirmation und Negation, Differenz und Dialektik festgelegt, so möchte das Projekt die Perspektive auf Modelle einer anderen Negativität freilegen, die sich als Zerfall und Deaktivierung ansprechen ließe. Denn in der Begegnung mit ästhetischen Phänomenen der Erosion, der Privation und des Verlusts finden die untersuchten Positionen einen Begriff von Negativität, dessen Kritikalität sich nicht mehr durch den starren Gegensatz von nietzscheanischer Affirmation und dialektischer Negation fassen lässt. Die Kunst wird für sie zum Ort, an dem sich eine andere Negativität manifestiert, eine Schattierung in der Negativität, die sich dieser etablierten Kategorisierung entzieht.
Am Ausgangspunkt der drei Positionen, denen die Dissertation gewidmet ist, steht damit eine Auseinandersetzung mit der Kunst, die zur Formulierung einer anderen Modalität der Negativität führt. Diese Konstellation spiegelt sich nicht zuletzt in einer auffälligen Tendenz zum Gebrauch privativer Präfixe in den jeweiligen Terminologien: Theodor W. Adornos Begriffe des „Zerfall“ und der „Entkunstung“, Georges Batailles Theorie der „décomposition“ und Giorgio Agambens Ästhetik des „désœuvrement“ und der „Deaktivierung.“ Die Differenzen zwischen diesen Ansätzen sind offenkundig und bekannt; ihre Verwandtschaft ist es nicht. Denn die Negativität, die mit diesen Begriffen auf eine je unterschiedliche Art umrissen wird, nennt eine Bewegung, die passiv, nicht progressiv; deaktivierend, nicht destruktiv ist. Keine heroische Figur des Finalität, eine fragile, brüchige Figur der Potentialität, die mit dem Ausgeschlossenem und Anderem, mit dem Überschuss an Möglichem solidarisch ist.
Thorsten Schneider
Mit dem Bezug auf Ideologiekritik um 1968 wurden in der jüngeren Kunstgeschichte der BRD zentrale Kategorien wie der Autonomiebegriff, die Ausrichtung des Faches auf einen vorwiegend historischen Kanon sowie die Überbetonung wissenschaftlicher Neutralität und politischer Distanz kritisiert. Ideologiekritik wurde dabei in der ihr zugeschriebenen Bedeutung für die Kunstgeschichte vorausgesetzt, ohne dass sie theoretisch weiter begründet worden wäre (vgl. Belting 1985, Gelshorn/Weddigen 2011, Pfister 2011, Brassat 2003, Marek 2015). Für die „ideologietheoretische Wende“ (Rehmann 2008) seit den 1960er Jahren ingesamt spielte daher die Kunstgeschichte so gut wie keine Rolle. Nachdem Ideologiekritik nach 1989 an Bedeutung verlor (vgl. Boltanski/Chiapello 2003), gibt es allerdings in der zeitgenössischen Kunstkritik wieder Ansätze zu ihrer Aktualisierung (vgl. Hinderer Cruz/Sonderegger 2014). Diese wiederum kommen ohne Referenzen auf die kunsthistorische Ideologiekritik um 68 aus. Genau diese Diskrepanz möchte ich überbrücken. Dazu bedarf es einer differenzierteren Darstellung von heterogenen Positionen, d.h. im Falle des Forschungsprojektes der Gegenüberstellung von (1) kritischer Kunstgeschichte, (2) der Radical Art History von O. K. Werckmeister, (3) des sozialgeschichtlichen Ansatzes (Held/Schneider) und (4) Peter Gorsens Reflexionen zur Entästhetisierung (Gorsen 1981). Eine solche Gegenüberstellung soll zeigen, wie in spezifischen Kontexten grundverschiedene Forschungsansätze entwickelt wurden, obwohl sich alle auf den Modus der Ideologiekritik beriefen. Eine Klärung der jeweiligen Ideologiebegriffe ist daher notwendig, zumal das kritische Selbstverständnis der jüngeren deutschsprachigen Kunstgeschichte wesentlich darauf beruht.
Meine Ausgangshypothese dabei ist, dass der analytische Wert kunsthistorischer Ideologiekritik für aktuelle Kunstkritik, die ihre theoretische Begründung verstärkt in anderen Feldern sucht, noch nicht ausgeschöpft ist. Es war der Anspruch kritischer KunsthistorikerInnen um 1968, Kunst nicht auf ein Widerspiegelungsmodell (Lukács) im gesellschaftlichen Überbau zu beschränken, sondern Ideologie und Kultur als relationale Faktoren des Kunstfeldes zu begreifen (vgl. Held/Schneider 2007). Diese politische Forschungshaltung möchte ich ernst nehmen und im Hinblick auf ihre Kritikfähigkeit unter der Maßgabe von aktuellen Auseinandersetzungen um den Ideologiebegriff erneuern.
Charlotte Nora Szász
Nach Immanuel Kant steht in der Tradition der europäischen Aufklärung ein Philosoph besonders für die bahnbrechende neue Methode um gesellschaftliche Ungleichheit fassbar machen zu können: G.W.F. Hegel. Durch ihn entsteht eine neue Gesellschaftskritik, um die Welt mit einer Perspektive auf Beherrschung und Unterdrückung fassbar machen zu können. Ein Standpunkt der Kritik ist entstanden, der eine kritische Standpunktontologie mitdenkt. Eine Methode, um einerseits unseren eigenen Standpunkt zu hinterfragen und andererseits einen identitätsontologischen Standpunkt vorzubeugen.
Die lange Tradition der Metamorphosen patriarchaler Hegelforschung soll in meiner Arbeit „Ewige Ironie – Weiblichkeit und Wissen bei Hegel“ durch die Inversion der gängigen These, der Mensch habe Geschlecht, Wissen aber nicht, gebrochen werden, um im Umweg über die Ironie, als die Schnittstelle von Wissen und Situiertheit, eine andere Konzeption von Geschlechterdifferenz zu fundieren und der Kritik einen Begriff an die Hand zu geben. Es ist der Versuch einer Verrückung der Geschlechtlichkeit aus ihrem gesellschaftlichen Erzeugungszusammenhang in einen hypostasierten Zusammenhang dinglicher Eigenschaften und naturgesetzlicher Zwänge.
In einer einer Querschnittanalyse des Werks Hegels kann ich zeigen, dass es systemrelevant und erkenntnisfördernd ist, wie Hegel die Wissensgestalt der Ironie mit dem Status des Weiblichen verbindet. Dass über eine vergleichende Perspektive der Gedanken Hegels zu Ironie, Weiblichkeit und Wissen und einer qualitativen Methodik der Erschließung des Ironiebegriffs heute gerade in der ontologischen Wende der Philosophie die Geschlechterfrage einen total wichtigen Ansatzpunkt bildet.
Der erste Teil der Arbeit widmet sich den Überlegungen Hegels zur Ironie im Spannungsfeld von subjektiver Allgemeinheit und Bezug zur Idee. Das heißt für Hegel: Ironie zwischen Romantik und sokratischer Methode. Im zweiten Teil der Arbeit wird der Bezug von Ironie zur Geschlechtlichkeit des Wissens hergestellt. Die Weiblichkeit ist bei Hegel eine Figur des Wissens, die nicht vollkommen im Endlichen aufgeht. Dieser Teil der Arbeit soll in einer ausführlichen Lektüre zweier Sätze bestehen, die zwar berühmt sind, aber bisher nur wenig aufmerksame Exegese erfahren haben. In diesen zwei Sätzen der Phänomenologie, spricht Hegel von der Weiblichkeit als der »ewige[n] Ironie des Gemeinwesens« (PG, S. 352f). Im dritten Teil soll das Problem der Geschlechtlichkeit von Wissen bei Hegel als zentrales Moment konstelliert werden.
Nele Wulf
Das geplante Dissertationsvorhaben interessiert sich für den Begriff und die Praxis der Immunisierung, respektive der Immunität im Kontext von Kunst und Kritik. Mit der Frage nach feministischer Kritik und Immunität in der Kunst seit den ausgehenden 1960er Jahren bis in die Gegenwart verfolgt die Arbeit eine doppelte Bewegung: Es soll untersucht werden, inwiefern feministische Kritik seither lediglich von den bestehenden Institutionen inkorporiert wurde, ohne dass sich grundsätzlich an deren Strukturen etwas geändert hätte. Gleichzeitig soll nach Immunisierungsstrategien von Künstlerinnen gefragt werden, die sich einer solchen Vereinnahmung durch die Institutionen zu entziehen versucht haben – und dies immer noch versuchen.
Der Begriff des Immunen, wie ihn die Philosophin Isabell Lorey formuliert, scheint dazu geeignet, um auf mehreren Ebenen die Praktiken und Diskurse der Vereinnahmung und Kritik zu untersuchen, da sich die von ihr gezeichneten ‚Figuren des Immunen’ sowohl in einer politisch/juridischen als auch in einer biologischen/biopolitischen Dimension bewegen. Ich möchte argumentieren, dass es insbesondere vor diesem Hintergrund lohnt, sich dem Verhältnis von feministischer Institutionskritik und den Institutionen der Kunst zu nähern. Damit lassen sich Kunstinstitutionen als immun, d.h. mit einem privilegierten und machtförmigen Schutzstatus ausgestattet, untersuchen. Die biologischen Implikationen, die die Metapher des Immunen beinhaltet, sollen außerdem Kunstinstitutionen und feministische Kritik innerhalb des Kunstfelds insofern in einen Zusammenhang mit dem Begriff der Biopolitik und Biomacht bringen, als ein großes Thema der feministischen Kritik die Regierung des weiblichen Körpers darstellte und darstellt. Weiterhin ist mir in der Auseinandersetzung mit (feministischer) Kritik über die Immunisierung – die ein zeitlicher Prozess ist – daran gelegen, Kritik an der Institution von der (möglichen) Konsequenz her zu denken. Statt sich einer normativen Dualisierung von gescheiterter oder geglückter Kritik hinzugeben, lassen sich heutige Darstellungsformen vergangener Kritiken vergegenwärtigen und nach der Art ihrer Integration befragen. In diesem Sinne ist die sich durch das Vorhaben ziehende Frage nicht zuletzt diese nach der Zeitlichkeit und Situiertheit von Kritik – in Zeiten einer attestierten ‚Krise der Kritik‘.