Die Bedeutung von Bodenmikroorganismen für eine nachhaltige Landwirtschaft
29.09.2019 Die intensive Landwirtschaft hat zu einer übermäßigen Verwendung von Mineraldüngern zur Steigerung der Pflanzenproduktivität geführt. Sie hat zudem enorme wirtschaftliche und ökologische Folgekosten sowie den Verlust der biologischen Vielfalt verursacht. Das Verstehen und Nutzbarmachen von Pflanzen-Mikroben-Interaktionen kann zu einem viel effektiveren Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft führen.
Nach Berechnungen der Vereinten Nationen werden im Jahr 2050 fast zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Um die Weltbevölkerung zu ernähren, braucht die Landwirtschaft neue Zielsetzungen. Mineraldünger, die in modernen Agrarökosystemen eingesetzt werden, sind weder effizient noch nachhaltig: „Die meisten Pflanzen nehmen nur einen Teil des ausgegebenen Düngers auf. Der Rest gelangt ins Grundwasser; die Böden versauern und Treibhausgase werden freigesetzt", erklärt Dr. Amit Kumar. Der Ökologe aus der Forschungsgruppe von Prof. Vicky Temperton forscht daher im Rahmen des Forschungsprojekts „INPLAMINT" innerhalb des BMBF-Programms ‚Boden als nachhaltige Ressource’ (BoNaRes) nach natürlichen Bodenprozessen. Er findet sie in der Vielfalt der Kulturpflanzen und in den Böden selbst: „Wir wollen die Wechselwirkungen des Pflanzen-Boden Mikroorganismus in Bezug auf Düngung und Pflanzenleistung besser verstehen. Bodenmikroorganismen haben das Potenzial, die Pflanzenleistung zu steigern. Wir wissen, dass bestimmte Bakterien und Pilze das Wachstum von Pflanzen fördern oder hemmen, aber wir verstehen nicht ausreichend warum. Im Moment ist es noch oft als ob wir in einer Blackbox etwas messen, doch wir wollen viel weiter gehen", sagt Dr. Kumar.
Die Ergebnisse des INPLAMINT-Konsortiums, zu dem auch Partner gehören, die sich mit Agronomie, Mikrobiologie, gasförmigen Emissionen und Ökosystemdienstleistungen befassen, zielen darauf ab, neue landwirtschaftliche Konzepte zur Reduzierung des Düngemitteleinsatzes bei gleichzeitig hohen landwirtschaftlichen Erträgen zu entwickeln. So ist beispielsweise aus der Agrarpraxis bekannt, dass der Anbau immer wieder gleicher Kulturen den Ertrag deutlich reduziert. Der Grund dafür ist, dass sich bestimmte Bodenpathogene ansammeln, wenn man die gleiche (Wirts-)Kultur kontinuierlich an einem Standort anbaut. Ist ein solcher Pflanzen-Boden-Feedback Effekt (PSF) stärker, wenn mehr Mykorrhiza Pilzarten beteiligt sind? Um dies zu beantworten, haben Kumar und Temperton ein Gewächshaus-Experiment mit Böden aus der Inden-Mine in Nordrhein-Westfalen eingerichtet, die eine ausgeprägte mykorrhizierende Pilz-Diversität beherbergen, und testen, ob die mikrobielle Bodensubstanz oder die Wirkung der aktuellen Pflanze die zukünftige Pflanzenleistung auf demselben Boden stärker beeinflusst. „Wir haben dort Böden gesammelt, da sie eine unterschiedliche mikrobielle Vielfalt aufweisen, und wir wollen die Auswirkungen dieser mikrobiellen Vielfalt auf die pflanzliche Leistung erfassen", erklärt Kumar.
Kumar hat bisher festgestellt, dass sowohl die Bodensubstanz als auch die aktuelle Kultur (Faba-Bohne oder Hafer) starke, aber unterschiedliche Auswirkungen auf die spätere Pflanzenleistung haben. Diese Ergebnisse sowie weitere Experimente sollten es ermöglichen, neue Verfahren des Fruchtfolgenmanagements vorzuschlagen, die dann für ihre jeweilige Ökosystemdienstleistung weiter getestet werden.
Die Forschung auf diesem Gebiet ist komplex, da die pflanzlich-mikrobiellen Wechselwirkungen unter realen landwirtschaftlichen Bedingungen oft von der Umwelt beeinflusst werden. Dr. Kumar arbeitet daher auch auf einem regulären landwirtschaftlichen Feld, auf dem er verschiedene Kulturen in Monokulturen und in einem "Zweierteam" anbaut. Die Auswahl der Pflanzen für dieses Mischkultur-Experiment basiert auf den mutualistischen Wechselwirkungen der Pflanzen mit bestimmten Bodenmikroorganismen. Diese neuartige Idee wird uns Erkenntnisse über die besten Kombinationen von Nutzpflanzen für Mischkulturen bringen, die den maximalen Nutzen aus der Mobilisierung von Ressourcen durch Mutualismus mit nützlichen Bodenmikroorganismen ziehen.
Darüber hinaus untersucht Kumar die Auswirkungen von Bodennährstoffen auf die verborgene Hälfte der Pflanze, die Wurzeln. Längere, dünnere Wurzeln eignen sich besser zur Aufnahme von Nährstoffen als kurze, dicke Wurzeln. Kumar untersucht, wie das Wurzelwachstum durch bestimmte Bodennährstoffe beeinflusst wird, so dass später spezifische Merkmale von Züchtern genetisch veränderter Pflanzen ausgewählt werden können, um neue Pflanzensorten zu entwickeln.
Diese zweite Phase des INPLAMINT-Projekts - die Steigerung der Effizienz der landwirtschaftlichen Nährstoffnutzung durch Optimierung der pflanzen- und bodenmikrobiellen Wechselwirkungen - wird vom BMBF mit rund 317.000 Euro gefördert.
Weitere Informationen
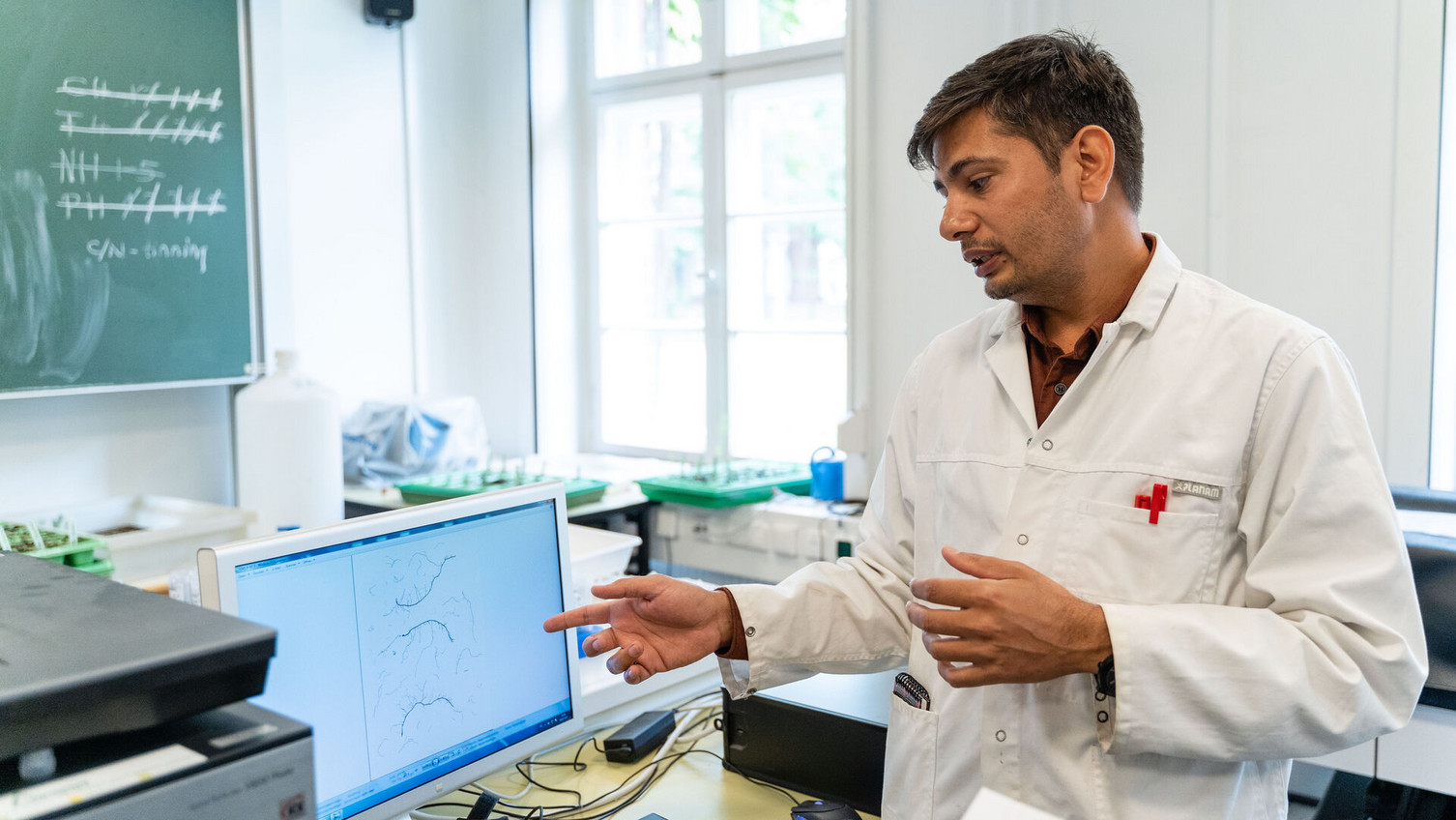 ©Leuphana/Patrizia Jäger
©Leuphana/Patrizia Jäger
