Interview mit Prof. Henner Gött zum neuen Band bei Oxford University Press
Wie internationale Organisationen sich verändern
06.07.2025 Am 3. Juni 2025 erschien der von Prof. Dr. Henner Gött, Honorarprofessor an der Fakultät Staatswissenschaften, gemeinsam mit Prof. em. Dr. Gabrielle Marceau (Universität Genf) herausgegebene Band „International Organization Initiatives – How and Why Organizations Adapt and Change“ bei Oxford University Press. Wir sprachen mit Prof. Gött über Initiativen internationaler Organisationen, den Blick aus der Praxis und wenig bekannte Mechanismen der Veränderung.
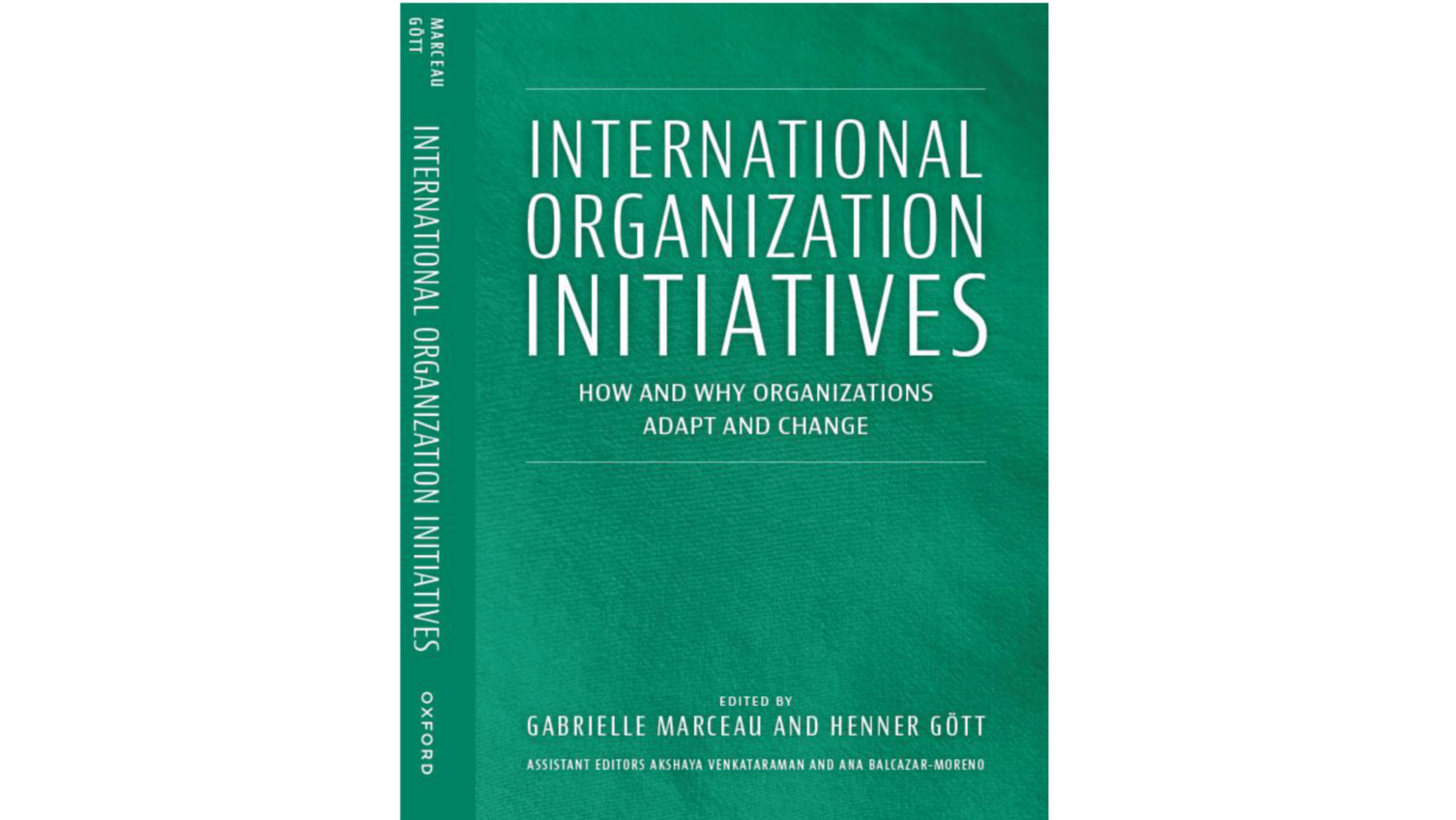 ©Oxford University Press (OUP)
©Oxford University Press (OUP)
Herr Professor Gött, worum geht es in Ihrem Buch?
Gött: In unserem Buch geht es darum, wie sich internationale Organisationen als Reaktion auf unvorhergesehene interne oder externe Bedürfnisse verändern. Solche Veränderungen verlaufen nach einem gewissen Muster: Bedürfnisse, die an die Organisation herangetragen werden, können dazu führen, dass die Organisation ihr Mandat mit ihren bisherigen Ansätzen nicht mehr ausreichend erfüllen kann. Zum Beispiel können bewaffnete Konflikte, die Klimakrise, Pandemien, aber auch das Aufkommen neuer Technologien oder veränderte politische Prioritäten von Mitgliedstaaten die an eine Organisation gestellten Erwartungen verändern. Dadurch kann sich die Organisation dazu veranlasst sehen, ihre Aktivitäten anzupassen oder neu auszurichten, was wiederum zu organisatorischer Veränderung führt. Dies hat über die Zeit in allen Organisationen, die wir untersucht haben, zu merklichem Wandel und Weiterentwicklung geführt. Und genau dieser Mechanismus interessiert uns, denn eine solche Veränderung fällt ja nicht vom Himmel. Sie ist das Ergebnis bewusster menschlicher Entscheidungen. Personen innerhalb der Organisation entscheiden sich dazu, Veränderung herbeizuführen – sie ergreifen die Initiative. Daher auch der Titel des Buches.
Der Begriff der „Initiative“ steht im Zentrum des Buches. Was verbirgt sich dahinter? Und wer sind die Personen, die Initiativen ergreifen?
Gött: Unter einer Initiative verstehen wir eine Handlung, die drei Voraussetzungen erfüllt: Erstens zielt sie darauf ab, auf ein Bedürfnis innerhalb oder außerhalb der internationalen Organisation zu reagieren. Zweitens ist sie für die Organisation neuartig. Und drittens geht sie über die Aktivitäten, Methoden oder Wege der Implementierung, die die Organisation bisher ausübt bzw. verwendet, hinaus und läutet dadurch eine Veränderung ein. In unserem Buch stehen Initiativen der Organisationssekretariate und deren leitender Beamter (also z.B. des UN-Generalsekretärs) im Zentrum der Aufmerksamkeit. In der Praxis werden Initiativen tatsächlich oftmals von Sekretariaten und deren Leitung angestoßen. Das ist auch wenig verwunderlich, weil Sekretariate aufgrund ihrer Eigenschaft als unabhängige, dem Organisationsinteresse verpflichtete Einrichtung, wegen ihres Fachwissens, ihrer eingeübten Praxis, des Charismas und der Führungsqualitäten ihrer Leitungen und weiterer Faktoren oftmals besonders dazu in der Lage sind. Natürlich müssen Sekretariatsinitiativen auch irgendwann von den Mitgliedsstaaten der Organisation akzeptiert werden. Und unsere Erfahrung zeigt, dass die Mitgliedstaaten später tatsächlich oft zustimmen oder sich der Initiative zumindest nicht aktiv widersetzen.
Es klingt so, als bräuchte man zur Erforschung von Initiativen genaue Einblicke in das Innenleben internationaler Organisationen. Wie haben Sie sich der Thematik genähert?
Gött: In dem Buch verfolgen wir einen zweigleisigen Ansatz. Zum einen finden sich darin Beiträge, die das Phänomen der Initiativen konzeptionell, rechtlich, politologisch und theoretisch einordnen und so die notwendigen Grundlagen bereitstellen. Diese Kapitel stammen von Wissenschaftler:innen, die einen Hintergrund im Völkerrecht oder internationalen Beziehungen haben. Zum anderen enthält das Buch eine Vielzahl von Beispielen für Initiativen aus internationalen Organisationen, die zumeist von Praktiker:innen beigesteuert wurden. Bei vielen dieser Kapitel handelt es sich um Augenzeugenberichte aus erster Hand, also von Personen, die selbst an den konkreten Initiativen mitgewirkt oder diese sogar selbst angestoßen und verantwortet haben und nun gewissermaßen als teilnehmende Beobachter:innen darüber berichten. Ein solcher Fundus von Praxisberichten aus dem Inneren internationaler Organisationen ist gleichermaßen selten wie wertvoll.
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Beiträge in ein bestimmtes theoretisches Vorverständnis einzuordnen, auch um zu verhindern, angesichts der reichlich existierenden theoretischen Literatur allzu voreingenommen an die Thematik heranzugehen. Stattdessen wollten wir den Stoff aus der Praxis heraus entwickeln. Darin liegt auch ein bedeutender Unterschied zu anderen Forschungsansätzen.
Was haben Sie dabei herausgefunden? Warum sollte man sich mit Initiativen beschäftigen?
Gött: Initiativen sind in vielen Fällen einer der Hauptantreiber von Veränderung in internationalen Organisationen gewesen. Es ist uns gelungen, ihre Struktur, ihre Wirkweise und ihre Erfolgsfaktoren genauer zu verstehen. Das hohe Innovationspotenzial und die Dynamik, die in den Initiativen zu Tage treten, sind bemerkenswert und entsprechen nicht dem bisweilen lancierten Bild von schwerfälligen, in internen Verfahren und geopolitischen Blockaden festgefahrenen Organisationen. Besonders gelohnt hat sich dabei der Blick auf die Organisationssekretariate und deren Leitungspersonen. Hier fanden wir eine ganze Welt wenig beschriebener, aber praktisch äußerst wirkungsvoller Mechanismen der Veränderung. Darin liegt eine praktisch nicht zu unterschätzende Ressource, derer sich Organisationen bedienen können, um in praxisorientierter und pragmatischer Weise Anpassungen vorzunehmen und so ihre Aufgaben angesichts sich verändernder Anforderungen weiterhin erfüllen zu können.
Unser Befund lädt zugleich auch dazu ein, etablierte Erklärungsmuster für internationale Organisationen und deren Veränderungen einer erneuten Bewertung zu unterziehen. Ich denke da etwa an funktionalistische Ansätze, die die prinzipale Rolle der Mitgliedstaaten betonen und die Rolle der Sekretariate oft vernachlässigen, oder das sog. Global Administrative Law, das Sekretariatsaktivitäten primär als Verwaltung begreift und dadurch deren proaktive, politische und teils pfadverändernde Eigenschaften zu übersehen droht. Aber auch so mancher mediale oder politische Abgesang auf internationale Organisationen könnte sich im Lichte der zahlreich belegten, oftmals erfolgreichen Initiativen als verfrüht herausstellen.
Wie kam es zu dem Buchprojekt?
Gött: Das Forschungsprojekt wurde sozusagen selbst aus der Praxis heraus geboren. Meine Mitherausgeberin Gabrielle Marceau hatte während ihrer aktiven Zeit bei der WTO Initiativen beobachtet und daraufhin mit ihrem Genfer Team erste Vermessungen des Phänomens durchgeführt. Ich selbst beschäftige mich seit meiner Promotion mit den Beziehungen internationaler Organisationen zu ihrer Umwelt - ein Bereich, in dem zahlreiche Initiativen ihren Ursprung finden. Das Buchvorhaben entstand 2022 im Nachgang zu einer Konferenz zu Initiativen in Genf. Wir hatten während des gesamten Projekts das große Glück, mit einem sehr kenntnisreichen und renommierten Kreis von Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen zusammenzuarbeiten.
Das Interview führte Jan Valentin Keller.
