Der Leuphana Salon
Lehre wird von vielen gestaltet: von Lehrenden und Studierenden, von den Mitarbeitenden der zentralen Einrichtungen, von einzelnen Akteuren und deren Initiativen. Der Leuphana Salon bietet allen, die auf diese Weise an der Entwicklung von Lehre mitwirken, die Möglichkeit, sich zentral zu präsentieren und ein Echo auf ihre Tätigkeit, auf aktuelle Überlegungen und Perspektiven einzuholen. Als offenes Salon-Format ohne enge Vorgaben, unterstützt vom Lehrservice Team, können alle Akteur*innen diese campusweite Möglichkeit des Austausches und der Präsentation nutzen. Der Leuphana Salon wurde im Ramens des Projekts „Leuphana... auf dem Weg!“ (LadW) initiiert und nach Projektende als Angebot verstetigt. Das Lehrservice-Team bewirbt die Salon-Veranstaltungen und stellt bisherige Erfahrungen zur Verfügung, um so zum Gelingen Ihres Salons beizutragen.
Leuphana Salon. DigiTaL - Praxistransfer für Lehrinnovationen
Von 2021 bis 2025 war das Projekt Leuphana: Digital Transformation Lab for Teaching and Learning (DigiTaL) ein systematisch-integrativer Ort zur Stärkung digitalen Lehrens und Lernens. Vielfältige Lehr- und Lerninnovationen sind entwickelt, erprobt und evaluiert worden. Einzelne Teilprojekte gingen im Leuphana Salon in den Austausch über Erfahrungen, Bedürfnisse und Inspirationen, insbesondere mit denen, die zukünftig die entwickelten digitalen Lehr- und Lerninnovationen nutzen werden. Im Rahmen des Leuphana Salons sollten Fragen zur Relevanz, Nutzbarkeit und zu den letzten Schritten hin zum gelungenen Praxistransfer diskutiert werden. Dabei wurden in kleineren Gruppen spezifische Projektergebnisse vorgestellt und diskutiert, um einen intensiven Theorie-Praxis-Transfer zu ermöglichen.
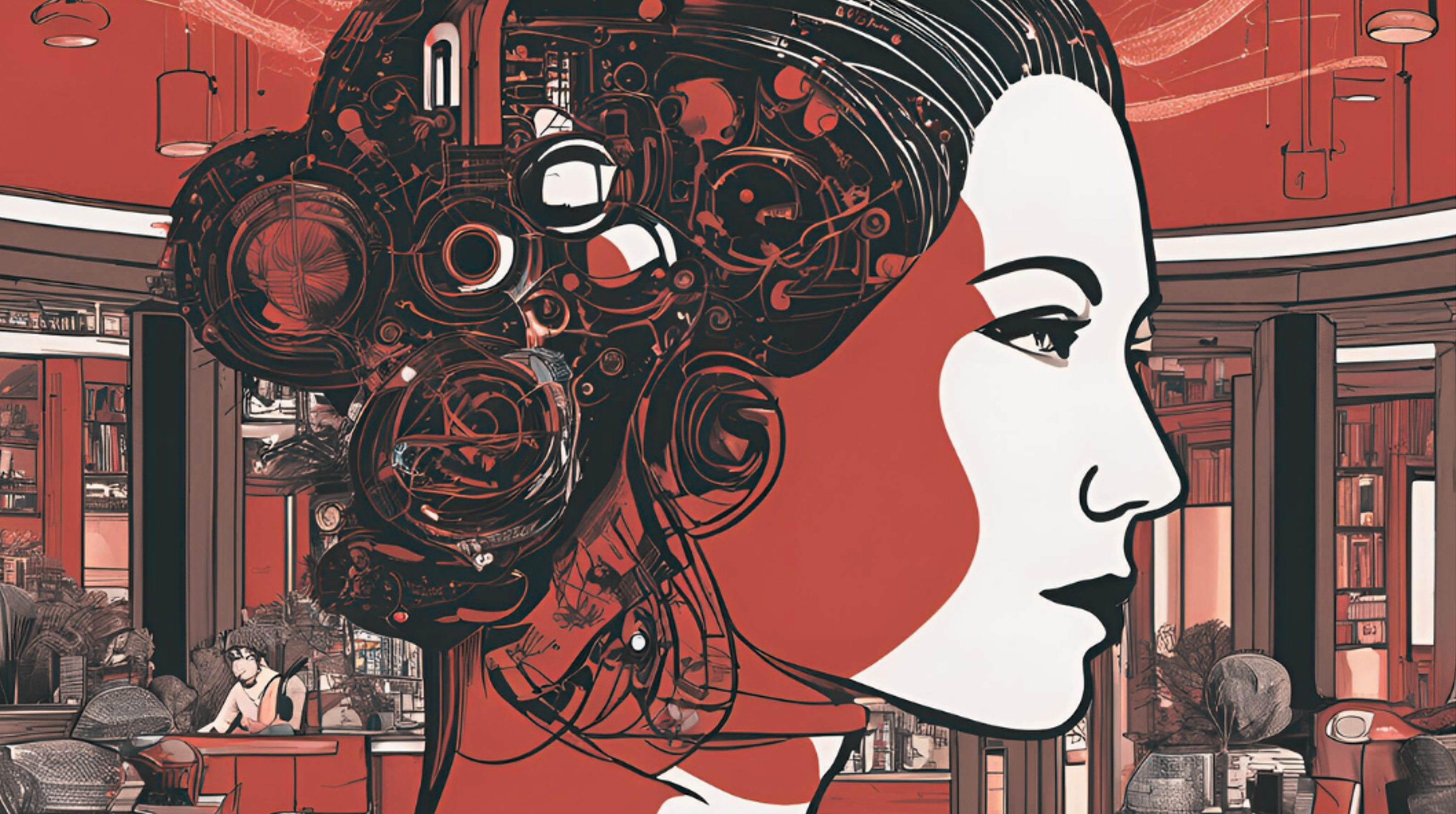 ©Leuphana, KI-generiert mit MagicMedia
©Leuphana, KI-generiert mit MagicMedia
WANN: 13.11.2024; 15 bis 16.15 Uhr
WO: Transformationsräumen (C25.019)
Workshop 1: KI-Feedback für Studierende ermöglichen
Lucas Jacobsen, Teilprojekt 2
Feedback ist einer der effektivsten Mittel zur Unterstützung des Lernens von Studierenden. Aufgrund finanzieller und personeller Hürden erhalten Studierende jedoch sehr selten Feedback. Generative KI kann hier eine potenziell zeitökonomische und hochqualitative Lösung darstellen. Die Fragen, die bearbeitet werden sollen lauten deshalb: Sehen Lehrende einen Mehrwert in der Bereitstellung von KI-Feedback für Studierende? Wenn ja, wie sieht die notwendige Unterstützung aus, damit Lehrende effektiv KI-Feedback in ihre Veranstaltungen integrieren können?
Workshop 2: Digital prüfen - jetzt und in Zukunft
Marieke Röben, Teilprojekt 5
Seit letztem Jahr ist das digitale Prüfen an der Leuphana in der Rahmenprüfungsordnung verankert. In diesem Workshop möchten wir uns auf die Frage(n) konzentrieren: Welche guten oder schlechten Erfahrungen wurden schon mit E-Prüfungen gemacht? Was bräuchte es, damit E-Prüfungen langfristig eine gute Option bleiben? Dabei sollen die Perspektiven der Lehrenden und die der Studierenden gemeinsam betrachtet und diskutiert werden.
Workshop 3: Digitale Lernspiele für den verantwortungsvollen Umgang mit KI und sozialen Medien
Britta Werksnis und Dr. Johannes Katsarov, Teilprojekt 8
Neue Technologien wie KI und soziale Medien bergen ein immenses Innovationspotenzial, das immer neue Früchte trägt. Leider gehen mit diesen Technologien auch vielfältige Risiken einher, die nicht offensichtlich sind. Wir laden Lehrende an der Leuphana ein, zwei unserer "Serious Moral Games" auszuprobieren und mit uns zu diskutieren. Es handelt sich um Lernspiele, die für den Unterricht erprobt sind, und für Ihre Lehre kostenfrei zur Verfügung stehen.
Im Workshop gibt es die Möglichkeiten, folgende Spiele in einer Kurzversion selbst zu spielen und dann gemeinsam mit uns über Einsatzmöglichkeiten zu diskutieren:
- CO-BOLD: Ein Serious Game zur verantwortungsvollen Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft. Das Spiel wurde mitsamt Unterrichtkonzept bereits mehrfach erfolgreich genutzt und erhielt den AACSB-Preis für "Innovations that Inspire".
- uFood: Ein Serious Game zur verantwortungsvollen Werbung mit sozialen Medien. Es wurde im Unterricht bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt und sensibilisiert Studierende vor allem für menschliche Schwächen der moralischen Wahrnehmung.
Außerdem wird es im Workshop einen kleinen Sneak-Peak zu SUPERPARK geben: Zurzeit entwickeln wir ein neues Serious Game zur verantwortungsvollen Automatisierung 4.0 in der Wirtschaft, bei welchem man diverse Prozesse in einem Freizeitpark automatisieren kann. Britta Werksnis wird als leitende Entwicklerin einen kurzen Einblick in das Spielkonzept geben und freut sich auf die Diskussion.
Archiv
Sie haben einen Leuphana Salon verpasst oder möchten noch einmal die Ergebnisse der letzten Veranstaltungen nachlesen?
In unserem Archiv finden Sie die Zusammenfassungen vergangener Leuphana Salons.
Kontakt
Christina Durant
Universitätsallee 1, C40.437
21335 Lüneburg
Fon +49 4131.677-4096
christina.durant@leuphana.de
